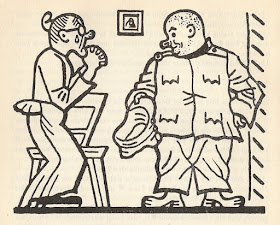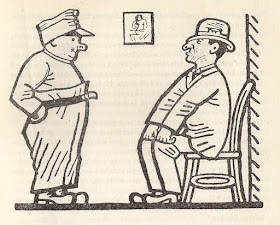Als unerschöptliche Quelle für die Entdeckung der nationalen Identität und die Herausbildung eines eigenständigen Stils diente die ungarische Volksmusik, die sie in schriftlichen und phonographischen Aufzeichnungen bei der Landbevölkerung sammelten. In nur wenigen Jahren trug Kodály drei- bis viertausend dieser Melodien zusammen, systematisierte sie und veröffentlichte sie zum Teil gemeinsam mit Béla Bartók. Diese Melodien unterschieden sich deutlich von den im 19. Jahrhundert so beliebten ”Zigeunermelodien”, die in Wirklichkeit im städtischen Milieu entstandene Kunstmusik sind. In den Volksliedern und der Tanzmusik, die Kodály und Bartók in den verschiedenen Regionen Ungarns entdeckten, waren die Irregularitäten nicht zurechtgestutzt und dem Dur-Moll-System und dem Symmetrie-Ideal der klassischen Melodiebildung angepaßt. Und in ihrer Ablehnung der spätromantischen Ausdrucksmittel waren es gerade diese Irregularitäten der Volksmusik, die sie erforschten und für die Moderne konstruktiv nutzten.
Allerdings nahmen Kodály und Bartók auf dem Gebiet der musikalischen Erneuerung entgegengesetzte Positionen ein: Bartók benutzte die ungarische Volksmusik als Ausgangspunkt für seine eigenen musikalischen Neuerungen. Indem er die Strenge der folkloristischen Melodien noch verstärkte, die Komplexität der rhythmischen Strukturen erweiterte und den Primitivismus intensivierte, folgte er den avantgardistischen Strömungen seiner Zeit und gelangte über die Volksmusik hinaus zu einer objektiven, Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebenden Musiksprache.
 |
| Zoltán Kodály |
Zoltan Kodály wurde am 16. Dezember 1882 in der kleinen ungarischen Stadt Kecskemét geboren. Als Junge sang er im Kirchenchor und lernte - praktisch als Autodidakt — Klavier, Geige, Bratsche und Cello. Er schrieb bereits erste Chorstücke, und eine 1897 komponierte Orchesterouvertüre wurde vom Schulorchester aufgeführt. 1900 ging er an die Musikakademie nach Budapest, um bei Hans Koessler Komposition zu studieren, belegte aber auch, seinen literarischen Interessen folgend, an der Universität ungarische und deutsche Sprachwissenschaft und Literatur. In diese Jahre fallen seine ersten Kammermusikkompositionen, die sich noch stark an dem Vorbild Brahms’ orientieren. Nach vier Jahren erhielt er sein Diplom als Komponist und 1906 schloß er seine Universitätsstudien mit dem Doktor ab. Seine umfangreichen Studien auf dem Cebiet der ungarischen Volksmusik begannen 1905 in Zusammenarbeit mit Béla Bartók. Er unternahm zahlreiche Reisen durch ganz Ungarn und zeichnete die Volksmelodien und -tänze der verschiedenen Regionen auf. Der Einfluß seiner Forschungen wird in seinen Kompositionen deutlich, die sich zunehmend vom Brahmsschen Stil abwenden und einen eigenen ungarischen Charakter entwickeln.
Internationale Anerkennung erlangte Kodály mit dem Psalmus Hungaricus (1923) und der Oper Háry János (1925), und in den folgenden Jahren avancierte Kodály zur bedeutendsten musikalischen Persönlichkeit Ungarns, die nicht nur als Komponist, sondern auch als Pädagoge, Musikkritiker und Musikwissenschaftler das Musikleben seiner Heimat entscheidend veränderte. Seine Bedeutung für das ungarische Kulturleben nahm nach dem zweiten Weltkrieg sogar noch zu, als er 1946 zum Präsidenten der Akademie der Wissenschaften gewählt wurde. Als einer der weitsichtigsten ungarischen Kulturpolitiker wurde er mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet, darunter allein dreimal mit dem neugegründeten Kossuth-Preis, und anläßlich seines 65. Geburtstags erhielt er das große Kreuz des Ordens der Volksrepublik. Kodály setzte sich für die Neugestaltung des Musikunterrichts in Ungarn durch die Gründung von Singschulen für Kinder und Entwicklung neuer Lehrmethoden ein. Auf den zahlreichen Auslandsreisen, bei denen er in erster Linie eigene Werke dirigierte, machte er die ungarische Musik und besonders das Werk seines früh verstorbenen Freundes Béla Bartók in der internationalen Musikwelt bekannt. Kodály starb am 6. März 1967 in Budapest.
 |
| Zoltán Kodály |
Die Sonate für Violoncello und Klavier op. 4 wurde 1909/10 komponiert und am 17. März 1910 von Jenö Kerpely und Béla Bartók in Budapest uraufgeführt. Das ursprünglich drei Sätze umfassende Werk zeigt schon deutliche Einflüsse seiner Volksmusikstudien. Bereits die Fantasia, mit der die jetzt zweisätzige Sonate beginnt, führt mit ihrer pentatonischen Motivik in die „altungarische“ Welt. Der improvisatorische Charakter dieses Satzes wird durch den rezitativischen Rubato-Stil und häufige Taktwechsel unterstützt. Obwohl der sehr lebhafte zweite Satz eine regelmäßige Sonatenform aufweist, treten die folkloristischen Bezüge hier noch klarer hervor. Neben der charakteristischen, auf Quarten basierenden Melodik ist es vor allem die Wiederkehr der Fantasia am Ende des zweiten Satzes, die die formale Geschlossenheit des Werkes betont.
Die drei Choralpräludien für Violoncello und Klavier (1924) sind Transkriptionen der Choräle für Orgel von Johann Sebastian Bach: Ach, was ist doch unser Leben BWV 743, Vater unser im Himmelreich BWV 762 und Christus, der uns selig macht BWV 747.
Quelle: Peter Noelke, im Booklet
TRACKLIST
Zoltán Kodály
(1882 - 1967)
Music for Cello
Three Chorale Preludes for Cello and Piano (1924)
[1] Ach was ist doch unser Leben (4:46)
[2] Vater unser im Himmelreich (4:00)
[3] Christus der uns selig macht (5:00)
Sonata for Solo Cello, Op. 8 (1915)
[4] Allegro maestoso ma appassionato (8:26)
[5] Adagio (con grand‘ espressiono) (11:31)
[6] Allegro molto vivace (11:03)
Sonata for Cello and Piano. Op. 4 (1909/10)
[7] Fantasia: Adagio di molto (9:27)
[8] Allegro con spirito - Molto adagio (10:17)
Playing Time: (64:28)
Maria Kliegel, Cello
Jenö Jandó, Pano
Recorded in the Clara Wieck Auditorium, Heidelberg.
in July, 1994 and in May. 1995.
Producer: Günter Appenheimer
Cover Painting; Michael Freeman: "Storm Object"
(P) + (C) 1996
Schillers köstliche Reste
 |
| Friedrich Schiller. Büste von Johann Heinrich Dannecker (1758-1841) |
Schwabe inszenierte ein würdiges Ereignis. Zwanzig schwarzgekleidete Männer fanden sich bei ihm ein. »Still und ernst begab sich nach Mitternacht der kleine Zug von Schwabes Wohnung nach Schillers Haus in der Esplanade. Es war eine mondhelle Mainacht, nur einzelne Wolken verhüllten bisweilen, unter ihm dahinziehend, den Mond. Still war das Totenhaus, nur Weinen und Schluchzen tönten dumpf aus dem Sarg, in welchem Schillers Leiche lag, naheliegenden Zimmer ... tiefe, lautlose Stille herrschte in der Stadt ...« Dann kam der Leichenzug zum Friedhof: »Hell durchbrach in diesem Augenblick der Mond die ihn verhüllenden Wolken und übergoß mit seinem ruhig freundlichen Lichte den Sarg des Dichters, ihm einen kurzen Abschiedsgruß sendend; gleich darauf verbarg sich die Lichtscheibe wieder hinter den rasch am Himmel dahinziehenden Wolken ... Kein Trauergesang, kein dem Andenken des eben Begrabenen geweihtes Wort aus priesterlichem Munde unterbrach das Schweigen der Mitternacht.« Es fehlte nur der Käuzchenschrei. So wurde Schiller sang- und klanglos beerdigt: als zweiundfünfzigste Leiche in einem Massengrab von zuletzt vierundsechzig Toten.
 |
| Kassengewölbe auf dem Jacobsfriedhof in Weimar |
Ende des Jahres 1825 meldete die Verwaltung, das Kassengewölbe müsse dringend »zusammengeräumt« werden, weil »fast gar kein Sarg mehr hineingestellt werden könne«. Das heißt: Das Kassengewölbe sollte geräumt, die Überreste der gestapelten Särge und Leichen auf einen Haufen getragen und am Rande des Friedhofs verscharrt werden. Das war ein reiner Verwaltungsakt. Doch Bürgermeister Schwabe wollte die Gelegenheit nutzen, um den Sarg Schillers zu bergen und für das geplante Grab- und Denkmal bereitzustellten. Am 13. März 1826 stiegen Bürgermeister Schwabe, Oberbaudirektor Coudray, Leibmedicus Dr. Schwabe und der Stadtschreiber und Hofadvokat Aulhorn in die Gruft. Dort herrschte »ein Chaos von Moder und Fäulnis und einzelner Stücke Bretter«, berichtet Schwabe später. Für eine Bergung kamen sechs Särge in Betracht. Als jedoch die Untersuchung der Namensschilder ins Leere führte, schien es unmöglich, »Gewißheit und Wahrheit darüber zu erlangen, welches hier die irdischen Überreste Schillers seien«. Das Unternehmen wurde abgebrochen. Der Totengräber erhielt die Order, alles so zu belassen, wie es ist.
Ohne die Behörden zu informieren, unternahm Schwabe die nächsten Schritte auf eigene Faust. Er bestellte den Totengräber Bielke und drei Tagelöhner für nachts zwölf Uhr auf den Friedhof und verpflichtete sie zu absolutem Stillschweigen. Dann brachen sie ins Kassengewölbe ein. Erst unten angekommen, wagten sie es, mehrere Laternen anzuzünden. Die Arbeiter begannen, die Reste der Särge auf der einen und die Knochen auf der anderen Seite aufzuschichten. Der Herr Bürgermeister saß derweil auf einer Leiter, beobachtete die Arbeit und qualmte durch »eifriges Tabakrauchen« gegen den Modergeruch und die unheimliche Stimmung an. So ging es drei Nächte lang, jeweils von Mitternacht bis zwei oder drei Uhr in der Früh. Am Ende hatte Schwabe dreiundzwanzig Schädel beisammen. Er ließ sie in einen Sack stecken und zu sich nach Hause bringen.
 |
| Grabstein Friedrich Schillers im Kassengewölbe |
Als in Weimar das eigenmächtige Vorgehen des Bürgermeisters bekannt wurde, schlugen die Wellen der Empörung hoch. Vor allem Familien, deren Angehörige im Kassengewölbe begraben waren, beschwerten sich. Doch der Großherzog und Goethe zeigten sich beglückt und zollten ihrem Bürgermeister »dankenste Anerkennung«. Doch wohin mit Schiller? Schwabe hatte vorgeschlagen: »Welche Zierde für den von mir so sehr gepflegten Gottesacker, wenn in einem einfachen Sarkophag, mit einer nur einfachen Säule hier Schillers Schädel der Erde übergeben würde, und zwar auf dem höchsten Punkt des Gottesackers, daß jeder Fremde […] schon aus der Ferne das Grab des geliebten Dichters erblicken und frei und ungehindert auf einen jedem zugänglichen Platz sich der Grabstätte nähern könnte!« Diesen Platz jedoch hatte sich der Großherzog ausgerechnet für die Fürstengruft auserkoren!
»Nur seine ohngefähre Ansicht als Privatperson« wolle er daher kundtun, meinte Karl August von Weimar, als er den Vorschlag machte, »ob es nicht am würdigsten wäre, wenn Schillers Schädel statt in die verhüllende und zerstörende Erde versenkt zu werden, lieber für immer auf der Bibliothek in einem besonderen, anständig eingerichteten Behältnis aufbewahrt würde.« Immerhin verfügte man auf diese Weise auch über den Schädel des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz.
 |
| Erinnerungstafel am Grab Carl Lebrecht Schwabes |
Der Großherzog erwarb derweil aus dem Schillerschen Familienbesitz die lebensgroße Marmorbüste, die der Bildhauer Dannecker unmittelbar nach dem Tod des Dichters gefertigt hatte, und stiftete sie der Familie. Dann, am 17. September 1826 um elf Uhr, wurde Schillers Schädel in einer Feierstunde in der Fürstlichen Bibliothek im Sockel der Marmorbüste deponiert. Bei dem Festakt waren weder der Großherzog noch Goethe anwesend. Karl August ließ sich durch den Kanzler von Müller vertreten. Goethe entschuldigte sich mit einer gesundheitlichen Schwäche, entsandte seinen Sohn August und entschwand mit seiner Schwiegertochter Ottilie aufs Land. Bei dem Festakt stellte August von Goethe ein Grabmal für die Gebeine Schillers, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht geborgen waren, in Aussicht. Der Schlüssel für das Postament aber »soll stets in den Händen der Großherzoglichen Oberaufsicht über die unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst bleiben«.
Der Schlüssel zu Schillers Schädel befand sich also in den Händen von Goethe persönlich. Geöffnet werde, so verkündete Goethe-Sohn August, das Reliquienkästchen des klassischen Weimar nur für Personen, bei denen man sicher sei, daß sie nicht aus Neugier oder Sensationslust kämen - Leute also, die einen Begriff davon hätten, »was jener große Mann für Deutschland, für Europa, ja für die ganze Welt geleistet hat«.
Schillers Schädel war gerettet. Doch was war mit seinen anderen Gebeinen? Wie sollte man in dem Knochenhaufen des Kassengewölbes ausgerechnet jene herausfinden, die dem Dichter gehörten? Da Schiller in Weimar als der längste, das heißt größte Bürger galt, brauchte man doch auch nur die längsten Knochen herausklauben. Gesagt, getan. Schon wenige Tage später, am 23. September 1826, stiegen der Chirurg und Aufseher des Anatomischen Kabinetts, Christian Schröter, und der frühere Bedienstete Christoph Färber nochmals hinunter ins Kassengewölbe. Nach einigen Tagen kamen sie mit allerhand Gebeinen wieder ans Tageslicht: Vierundsiebzig Knochen, darunter das zwischen dreiundzwanzig Skeletten entdeckte erste Glied der linken großen Zehe Schillers. Einhundertacht Teile des Gerippes wurden als Verlust registriert, darunter das Schwanzbein und siebenundzwanzig Zehenglieder. Die neunundzwanzig Knochenteile des bereits geborgenen Schädels dazugezählt, heißt das nichts anderes: hier war nicht mal mehr der halbe Schiller vorhanden.
Ohne jede Feierlichkeit wurde am 27. September 1826 der restliche Schiller, getrennt von seinem Schädel, in einer Kiste in einem der unteren Räume der Bibliothek beigesetzt.
Bereits in der Nacht vom 25. auf den 26. September 1826 beherbergte Goethe den Schädel des Dichter-Freundes im Gartenhaus seines Anwesens am Frauenplan. Es war die Nacht, in der er sein berühmtes Gedicht Auf Schillers Schädel schrieb. Der Ort des Geschehens ist die Anonymität des »Beinhauses«: Viele Schädel und Knochen liegen ungeordnet nebeneinander. Niemand weiß, von wem und mit welcher Geschichte. Der Blick des Besuchers ist glücklicherweise kraniologisch geschult. Unter all den bedeutungslosen Knochenteilen erkennt er daher ohne Umschweife den Schädel des Dichtergenies: »Mir Adepten war die Schrift geschrieben, / Die heilgen Sinn nicht jedem offenbarte«.
Noch Ende des Jahres beherbergte Goethe die teure Reliquie, gebettet auf blauem Samt unter einem Glassturz in seinem Hause. Am 29. Dezember 1826 berichtete Wilhelm von Humboldt seiner Frau: »Heute nachmittag habe ich bei Goethe Schillers Schädel gesehen. Goethe und ich — Riemer war noch dabei — haben lange davor gesessen, und der Anblick bewegt einen gar wunderlich. Was man lebend so groß, so teilnehmend, so in Gedanken und Empfindungen bewegt vor sich gesehen hat, das liegt nun so starr und tot wie ein steinernes Bild da. Goethe hat den Kopf in seiner Verwahrung, er zeigt ihn niemand. Ich bin der einzige, der ihn bisher gesehen, und er hat mich gebeten, es nicht zu erzählen.«
Zu Goethes achtundsiebzigstem Geburtstag meldete sich überraschend der König von Bayern zu Besuch. Der dichtende König machte dem König der Dichter seine Aufwartung! Am 29. August 1827 teilte Karl August dem Freund kurz mit, daß er gegen zehn Uhr am Frauenplan vorfahre. »Hernach möchte der König die Bibliothèque und daselbst Schillers Schädel sehn! Letzteres kannst Du nur möglich machen, deswegen ersuche ich Dich, die nötigen Anstalten dazu treffen zu lassen.« Der bayerische König zeigte sich tief beeindruckt, war aber durch die getrennte Aufbewahrung von Kopf und dem restlichen Gebein etwas irritiert.
 |
| Karl August Herzog von Sachsen-Weimar und Eisenach. Gemälde von Georg Melchior Kraus, um 1796. Goethe Nationalmuseum Weimar. |
Dann teilte im September 1827 der Großherzog seinem Minister Goethe mit: »Es wird so verschiedentlich über die Aufbewahrung der Schillerschen Reliquien auf hiesiger Bibliothèque hin und her geurteilt und meistens wohl mißbilligt, daß ich es für rathsam halten möchte, selbige in dem Kasten, in welchem sie liegen, inclusive des Hauptes, von welchem vorher ein Abguß zu nehmen wäre, in die Familiengruft einstweilen setzen und aufheben zu lassen, welche ich für mein Geschlecht auf dem hiesigen neuen Friedhof habe bauen lassen, bis daß Schillers Familie einmal ein anders darüber disponiert. So Du hiermit einstimmst, so werde ich dem Hofmarschallamte die Anweisung geben, Schillers Überbleibsel unter seinen Beschluß bei meinen Ahnen zu nehmen.«
 |
| Fürstengruft in Weimar |
Zweifel an der Echtheit des Schillerschen Schädels kamen ein halbes Jahrhundert später erneut auf. Der Anthropologe Hermann Welcker, Direktor des Anatomischen Instituts in Halle, hatte ein neues Verfahren der Schädelmessung entwickelt. Danach war es möglich, einer Person nach Bildern und Büsten den richtigen Schädel zuzuordnen. Auf diese Weise wurden die Schädel Schillers, Kants und Raffaels untersucht. Welcker kam zu dem Ergebnis, die Schillersche Totenmaske aus Gips passe nicht mit der Schädelmaske überein. (Schillers Schädel und Totenmaske nebst Mitteilungen über Schädel und Totenmaske Kants. 1883. Neudruck 1933)
Die Diskussion unter den Anatomen begann. Bis 1911 der Tübinger Anatom August von Froriep seinem Kollegen Welcker zustimmte: Toten- und Schädelmaske ließen sich in den Profilen nicht miteinander konturieren. Auch die Gipsmaske käme nicht in Frage, da sie wesentlich größer sei als das Original. Froriep entschied sich für die Terrakotta-Maske, die der Bildhauer Keller angefertigt hatte. Froriep ließ die Gruft des 1854 abgerissenen Kassengewölbes wieder aufgraben und holte einen Schädel aus der Tiefe, der in allen Hauptabmessungen der Totenmaske aus Terrakotta entsprach. Er barg dreiundsechzig Schädel. Schädel Nummer vierunddreißig, behauptete Froriep‚ sei der echte. Eine Gutachterkommission bestätigte ihm die Echtheit.
Froriep barg bei der Gelegenheit gleich auch noch ein Skelett, das er Schiller zuordnete. So gab es plötzlich zwei Skelette des Dichters. Aus Pietät sind die Knochenreste in einen schwarzen Holzsarg verpackt worden, den man am 9. März 1914 auch noch in die Fürstengruft stellte, allerdings durch einen Vorhang verdeckt. Der Sarg des »Unbekannten« trägt die Nummer III und stand jahrzehntelang hinter dem südwestlichen Pfeiler.
Nun gab es — eine einmalige Kuriosität — zwei Schiller-Schädel und zwei Schiller-Skelette. Allerdings wurde dem 1826 gefundenen der Vorzug gegeben, denn noch im Jahre 1913 behauptete ein anderer Anatom namens Neuhauß, der von Froriep entdeckte Schädel könne wegen offensichtlicher weiblicher Merkmale nicht Schiller zugeschrieben werden.
 |
| Die Gräber in der Fürstengruft Weimar |
In seinem Buch Ich suchte Gesichter (Gütersloh 1968) beschreibt Gerassimow im Detail, wie er den ursprünglich von Schwabe geborgenen und von Welcker geprüften Schädel Schillers erneut untersuchte. Anhand der im Museum für Urgeschichte in Weimar hergestellten Kunststoffgüsse »beider« Schillerschädel, deren Aussehen er nach einer von ihm selbst entwickelten Methode rekonstruierte, wies er »zweifelsfrei« die Identität mit Schiller nach. Der »Froriep-Schädel« schied aus: Er gehörte zu einer jungen Frau. Allerdings gab es auch hier Probleme, etwa mit den morphologischen Eigentümlichkeiten der Nasenlippenfalte. Schließlich gelang es Gerassimow, festzustellen, warum Welcker sich geirrt hatte. Der Bildhauer hatte Schillers Haar mit einem Tuch umwickelt und zum Beseitigen der Gewebespuren den Gips abgeschabt. So kam es zur verformten Kopfwölbung der Totenmaske. Weiterhin erbrachten die Untersuchungen der aufgefundenen Skelettknochen‚ daß das 1826 geborgene Skelett tatsächlich das von Schiller war.
Erneute Zweifel wurden im Jahre 2005 laut, dem zweihundertsten Todestag Schillers. Gerassimow habe in seinem Bericht verschwiegen, so Peter Braun, daß dem aus der Holzsäule der Bibliothek entnommenen und in die Fürstengruft überführten Schädel, den er für echt erklärte, ursprünglich acht Zähne fehlten, die aber ersetzt worden waren. Schwabe aber spricht bei dem von ihm gefundenen Schiller-Schädel von nur einem fehlenden Zahn. Nun aber ist Schwabe vorgeworfen worden, er habe sieben der acht fehlenden Zähne dem größten der aufgefundenen Schädel eingesetzt, um ihn als Schädel Schillers auszuweisen. Denn er habe gewußt, daß Schillers wirklicher Schädel nicht mehr zu bestimmen gewesen sei.
Braun stellte fest, daß in der Fürstengruft zwei Sarkophage standen, die Schiller zugeordnet waren. »Der im Plan der Fürstengruft mit I bezeichnete, bekannte, mit dem Namen Schillers versehene Sarkophag, und ein mit III bezeichneter, namenloser Sarkophag mit der Angabe ›Unbekannt (1911 von der Forschung für den Schädel Friedrich Schillers gehalten).‹ Sarkophag III steht nicht mehr an der bezeichneten Stelle.« Auf eine entsprechende Frage an die Stiftung Weimarer Klassik, wo sich der Sarkophag III denn jetzt befände, erhielt Braun keine Antwort.
Fazit: Zwei Schädel, zwei Skelette, zwei Särge. Hinzu kommen verschiedene Totenmasken, auch elf als »Schillerhaar« bezeichnete Haarbüschel unterschiedlicher Farbe und verschiedener Wellung und Kräuselung, die sich an fünf verschiedenen Orten befinden — drei von ihnen sind übereinstimmend. Einer Gen-Analyse aller Schiller zugeordneten Knochen, Schädel und Haare aber wurde von der Stiftung Weimarer Klassik nicht zugestimmt. Der Verbleib von Sarkophag III ist ungeklärt.
Literatur: Julius Schwabe: Schillers Beerdigung und die Auffindung und Beisetzung seiner Gebeine. 1805, 1826, 1827. Leipzig 1852. Neudrucke: 1932, 1934 und 1936 ; Max Hacker: Schillers Tod und Bestattung. Leipzig 1935 ; H. Ulrich: Neue wissenschaftliche Untersuchungen über die Echtheit des Schillerschädels. Jena 1962 ; H.-J. Scharf: Der Anatomenstreit um Schillers Schädel. Nova Acta Leopoldina. Neue Folge 171, Band 29, 1964, Seiten 179 bis 194 ; Die Zeit vom 27. September 1985 ; Johannes Lehmann: Die Schädelstatten unserer Klassiker, Stuttgarter Zeitung vom 27 März 1999 ; Albrecht Schöne: Schillers Schädel. München 2002 ; Peter Braun: Schiller, Tod und Teufel. Düsseldorf 2005
Quelle: Lemma "Schillers köstliche Reste" in: Rainer Schmitz: Was geschah mit Schillers Schädel? Alles, was Sie über Literatur nicht wissen. Eichborn Berlin, Frankfurt am Main, 2006. ISBN 3-8218-5775-7. Seiten 1242-1250
Lust auf weitere Cellosonaten und noch mehr Essays? ... Bitte schön:
Max Reger: Sonaten für Violoncello und Klavier | Umberto Eco: Reflexionen über Bibliophilie
Anton Rubinstein (1829-1894): Cello Sonaten | Manlio Brusatin: Auftauchen und Verschwinden der Bilder
Schubert: Arpeggione Sonate (Benjamin Britten, Mstislav Rostropovich, 1968) | Humor in der Mathematik: Das allgemeine Dreieck
Krzysztof Penderecki: Divertimento for Solo Cello | Gedichte von Philip Arthur Larkin (1922-1985)
Pierre Fournier, Violoncello (1961/1967) (keine Sonaten, sondern Konzerte :-)) | Diego Velazquez: Die Übergabe von Breda, 1635
CD bestellen bei JPC
CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Pictures) 12 MB
embedupload --- MEGA --- Depositfile
Unpack x359.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the FLAC+CUE+LOG files [64:28] 3 parts 223 MB