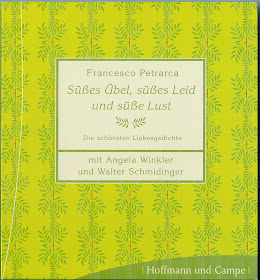Holliger selbst blieb nicht nur der instrumentale Neuerer, der herausragende Mozart-Spieler, der Wiederentdecker eines (vielleicht seelenverwandten) eigenwilligen und zu Unrecht vergessenen Komponisten wie Jan Dismas Zelenka, sondern strebt, auch als Komponist, nach größter Intensität des Ausdrucks. Darauf weist schon die Reihe der Dichter hin, mit denen er sich in Stücken, die nicht immer Vertonungen im herkömmlichen Sinn sind, auseinandergesetzt hat: Georg Trakl (Drei Liebeslieder, 1960; Siebengesang, 1967), Nelly Sachs (Glühende Rätsel, 1964; Der magische Tänzer, 1963/65), Paul Celan (Psalm, 1970/71), Samuel Beckett (Come and Go, 1976/77; Not I, 1978). Mit meinem »Psalm«, dem »Streichquartett« und vor allem mit »Atembogen für Orchester« näherte ich mich einer Musik, schreibt Holliger, deren klangliche Erscheinung für mich nur von sekundärer Bedeutung war gegenüber dem Fühlbar-, ja Sichtbarmachen der extremen physischen und psychischen Bedingungen, unter denen diese Klänge entstehen.
Tatsächlich wandte er sich, schon im virtuosen Siebengesang (1967), noch deutlicher in Pneuma für Orchester (1970), immer entschiedener Grenzsituationen zu: Grenzbereichen des Klangs, manuellen oder überhaupt physischen Grenzen des Instrumentalspiels, Grenzen des musikalisch (gerade noch) Sagbaren. Die Stücke, nicht unbedingt im herkömmlichen Sinn Musik, zeigen dabei eine sonderbare Ambivalenz: der ungehemmten Emotion steht eine bis ins kleinste ausgetüftelte Konstruktion gegenüber.
Das Streichquartett, dem bedeutenden Förderer Neuer Musik Paul Sacher gewidmet, am 10. September 1973 vollendet und am 23. März 1975 beim Festival d'Art Contemporain in Royan vom Berner Streichquartett uraufgeführt, besteht aus neun ineinander übergehenden Teilen (acht Abschnitte und eine Coda), deren Spannungskurve vom fiebrigen, hektisch-verkrampften Beginn bis zum allmählichen Ersterben, zum Erstarren reicht. Quasibiologische Vorgänge sind auskomponiert: jede der gewöhnlichen und ungewöhnlichen Arten, das Instrument zu traktieren, wird bis zur letzten Konsequenz geführt, jeder Verlauf an die Grenze der Erschöpfung getrieben.
So führt etwa das Spiel "sul ponticello" (am Steg) den Bogen schließlich ganz an den Steg, dann hinter den Steg, zuletzt auf den Saitenhalter, bis der Bogen beängstigend nahe am Hals des Spielers entlangführt. So wird der Bogendruck schrittweise bei gleichzeitiger Verlangsamung der Bogenbewegung erhöht, so daß der Geräuschanteil der Töne sukzessive steigt, bis vollständige Lähmung eintritt. So werden insgesamt viermal die Saiten aller vier Instrumente (außer der jeweils höchsten der Violinen und der Bratsche) herabgestimmt, die Quintintervalle zwischen den Saiten gespreizt, und das Ende, gewissermaßen der physische Tod des Klangs, tritt zwangsläufig ein, wenn die Spannung der herabgestimmten Saiten so verringert ist, daß nichts mehr außer leisen Bogengeräuschen und dem erschöpften Atmen der Musiker hörbar wird. Verschiedene Grade gegenseitiger Abhängigkeit und Unabhängigkeit sind auskomponiert, nicht nur zwischen den Instrumenten, sondern selbst innerhalb einer Stimme: analog wie in Vinko Globokars Limites für einen Streicher ist über längere Strecken jedes Instrument getrennt nach Griffhand und Bogenhand in zwei Systemen notiert, was den Spieler in eine spannungsvolle, quasi gespaltene Bewußtseinslage bringt.
 |
| Heinz Holliger |
Holliger vollzieht dieses Sichentziehen in die Stille, in die Kommunikationslosigkeit nach. Der Frühling, lauter Dreiklänge, die dennoch gegen einen funktionsharmonischen Zusammenhang sich sperren, wird mit Atemverkrampfungen und - was äußerst schwierig ist - beim Einatmen gesungen. Der Sommer ist ein merkwürdiger Kanon: vier bis acht Sängerinnen wählen eines von vier Gedichten und singen (unabhängig von den anderen) im Tempo des jeweils eigenen Pulsschlags, nacheinander einsetzend. Die Töne der zugrundeliegenden Zwölftonreihe werden einer nach dem anderen »ausgelöscht«; bis nur noch stumme Lippenbewegungen übrigbleiben. Der Herbst - hier in einer von Clytus Gottwald ausgearbeiteten Version - besteht aus Oberton-Akkorden in teils extremen Stimmlagen über sehr tiefen Baßtönen. Der Chor ist in vier Gruppen (jeweils Sopran, Alt, Tenor und Baß) geteilt; verschiedene Sänger und der Dirigent sprechen die Datierungen wie eine falsch gehende »sprechende Uhr« am Ende der gesungenen Verszeilen. Der Winter: das Klangnegativ eines Bach-Chorals (Komm, o Tod, du Schlafes Bruder), bei dem die Töne des Chorals zu Pausen der Musik werden, die Holliger mit gesprochenen einzelnen Silben des Gedichts »auffüllt« - musikalisch und in der Sprachbehandlung ein Abbild von Isolation und Zerfall, einer Zerstörung, die die Schönheit von Ruinen in sich trägt.
Die Chaconne für Violoncello solo (1975) ist eines der zwölf Werke über die Töne (e) S-A-C-H-E-R (e), die von befreundeten Komponisten (Boulez, Berio, Britten, Dutilleux, Henze, Huber, Lutoslawski, Fortner u. a.) zu Paul Sachers siebzigstem Geburtstag geschrieben worden sind. Das streng isorhythmisch gebaute Stück besteht aus sechs Abschnitten, deren Tempo und Dichte stufenweise gesteigert werden, sowie einem (utopischen?) P(ost) S(criptum).
Quelle: Dietmar Polaczek, im Booklet
TRACKLIST Heinz Holliger (* 1939) Streichquartett - Die Jahreszeiten - Chaconne (1) Streichquartett (1973) 26'53 Berner Streichquartett (Alexander van Wijnkoop, Violine; Eva Zurbrügg, Violine; Henrik Crafoord, Viola; Walter Grimmer, Violoncello) (2) Die Jahreszeiten (1975) 17'57 Vier Lieder nach Gedichten von Scardanelli (Hölderlin) für gemischten Chor Der Frühling / Der Sommer / Der Herbst / Der Winter Schola Cantorum Stuttgart, Leitung: Clytus Gottwald (3) Chaconne für Violoncello solo (1975) 7'33 Walter Grimmer, Violoncello Gesamtlaufzeit: 52'23 Aufnahme: März 1979 [1] und Mai 1979 [3] in der Kirche Reutigen (Bern) Aufnahmeleitung: Heinz Holliger / Tontechnik: Jakob Stämpfli Mai 1977 [2] / Produktion des Südwestfunks, Baden-Baden Aufnahmeleitung: Clytus Gottwald / Tontechnik: Hugo Herold AAD ® 1979/1991
 |
| Friedrich Hölderlin. Pastell von Franz Karl Hiemer (1792) |
DER FRÜHLING
Es kommt der neue Tag aus fernen Höhn herunter,
Der Morgen, der erwacht ist aus den Dämmerungen,
Er lacht die Menschheit an geschmükt und munter,
Von Freuden ist die Menschheit sanft durchdrungen.
Ein neues Leben will der Zukunft sich enthüllen,
Mit Blüthen scheint, dem Zeichen froher Tage,
Das große Thal, die Erde sich zu füllen,
Entfernt dagegen ist zur Frühlingszeit die Klage.
d: 3ten März 1648 Mit Unterthänigkeit Scardanelli
DER SOMMER
Im Thale rinnt der Bach, die Berg an hoher Seite,
Sie grünen weit umher an dieses Thales Breite,
Und Bäume mit dem Laube stehn gebreitet,
Daß fast verborgen dort der Bach hinunter gleitet.
So glänzt darob des schönen Sommers Sonne,
Daß fast zu eilen scheint des hellen Tages Wonne,
Der Abend mit der Frische kommt zu Ende,
Und trachtet, wie er das dem Menschen noch vollende.
d. 24 Mai mit Unterthänigkeit
1758. Scardanelli
DER SOMMER
Die Tage gehn vorbei mit sanffter Lüffte Rauschen,
Wenn mit der Wolke sie der Felder Pracht vertauschen,
Des Thales Ende trifft der Berge Dämmerungen,
Dort, wo des Stromes Wellen sich hinabgeschlungen.
Der Wälder Schatten sieht umhergebreitet,
Wo auch der Bach entfernt hinuntergleitet,
Und sichtbar ist der Ferne Bild in Stunden,
Wenn sich der Mensch zu diesem Sinn gefunden.
d. 24 Mai Scardanelli
1758
DER SOMMER
Noch ist die Zeit des Jahrs zu sehn, und die Gefilde
Des Sommers stehn in ihrem Glanz, in ihrer Milde;
Des Feldes Grün ist prächtig ausgebreitet,
Allwo der Bach hinab in Wellen gleitet.
So zieht der Tag hinaus durch Berg und Thale,
Mit seiner Unaufhaltsamkeit und seinem Strale,
Und Wolken ziehn in Ruh, in hohen Räumen,
Es scheint das Jahr mit Herrlichkeit zu säumen.
d. 9ten März mit Unterthänigkeit
1940 Scardanelli
DER SOMMER
Wenn dann vorbei des Frühlings Blüthe schwindet,
So ist der Sommer da, der um das Jahr sich windet.
Und wie der Bach das ThaL hinuntergleitet,
So ist der Berge Pracht darum verbreitet.
Daß sich das Feld mit Pracht am meisten zeiget,
Ist, wie der Tag, der sich zum Abend neiget;
Wie so das Jahr verweilt, so sind des Sommers Stunden
Und Bilder der Natur dem Menschen oft verschwunden.
d. 24 Mai Scardanelli
1778
DER HERBST
Das Glänzen der Natur ist höheres Erscheinen, "den 3ten März 1648"
Wo sich der Tag mit vielen Freuden endet, "den 24. April 1839"
Es ist das Jahr, das sich mit Pracht vollendet, "den 24. Mai 1778"
Wo Früchte sich mit frohem Glanz vereinen. "den 25. Dezember 1841"
Das Erdenrund ist so geschmükt,
und selten lärmet "den 9. März 1940"
Der Schall durchs offne Feld,
die Sonne wärmet "den 15. März 1842"
Den Tag des Herbstes mild,
die Felder stehen "den 15. November 1759"
Als eine Aussicht weit,
die Lüffte wehen
Die Zweig und Äste durch
mit frohem Rauschen, "den 24. Mai 1758"
Wenn schon mit Leere
sich die Felder dann vertauschen, "den 28ten Juli 1842"
Der ganze Sinn
des hellen Bildes lebet "den 24. April 1849"
Als wie ein Bild,
das goldne Pracht umschwebet. "den 24. Januar 1676"
"Dero unterthänigster Scardanelli"
DER WINTER
Das Feld ist kahl, auf ferner Höhe glänzet
Der blaue Himmel nur und wie die Pfade gehen,
Erscheinet die Natur, als Einerlei, das Wehen
Ist frisch, und die Natur von Helle nur umkränzet.
Der Erde Stund ist sichtbar von dem Himmel
Den ganzen Tag, in heller Nacht umgeben,
Wenn hoch erscheint von Sternen das Gewimmel,
Und geistiger das weit gedehnte Leben.
"den 24. Januar 1743 - Mit Unterthänigkeit - Scardanelli"
Die Essenz schlechthin
Blinde Flecke – oder: Was Kunst-Grossanlässe und Filet-Vegetarier mit einander gemein haben
 |
| David Teniers d. J.: Erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Gallerie in Brüssel. Öl auf Leinwand, 123 x 165 cm, circa 1650. Kunsthistorisches Museum, Wien [Beschreibung der Bildtitel] |
Bei Grossausstellungen mit zeitgenössischer Kunst ist regelmässig nicht nur von jenen Werken die Rede, die gezeigt werden, sondern auch von allem, was fehlt. Namentlich bei thematischen Shows fällt uns schnell das eine oder andere ein, das hier ebenso gut, wenn nicht gar besser gepasst hätte. Allerdings stehen auch Grossausstellungen ohne strenge thematische Matrix regelmässig unter dem Verdacht, für gewisse Bereiche der zeitgenössischen Kunst kein Auge zu haben, sie bewusst oder unbewusst auszusparen. Im Rahmen der «Mediations»-Biennale, die vom 14. September bis zum 14. Oktober 2012 im polnischen Poznan stattfindet, wird nun gar ein Symposium veranstaltet, das sich unter dem Titel «The Unshown» den blinden Flecken von Grossausstellungen wie der gegenwärtigen Documenta widmet.
Ein Welt-«Best-of»
Der Begriff des blinden Flecks bezeichnet in erster Linie eine kaum wahrnehmbare Stelle in unserem Gesichtsfeld, von der aus keine visuellen Informationen an unser Gehirn weitergeleitet werden. Die Frage nach dem blinden Fleck impliziert also gewissermassen auch, dass im Grunde das meiste wahrgenommen wird. Bei Grossausstellungen wie manchen Biennalen oder der Documenta gehen wir denn auch davon aus, dass eine solche Weltkunstschau zunächst alles zur Kenntnis nimmt, was da ist, zumindest, was da in Sachen Kunst gemacht wird – und uns dann, dies ist die Arbeit der Kuratoren, eine Auswahl, ein «Best-of», präsentiert.
Diese Vorstellung steht in krassem Widerspruch zu der immer wieder formulierten Feststellung, dass heute weltweit so viel Kunst gemacht wird, dass niemand, auch ein grösseres Team nicht, mehr den Überblick über die Dinge haben kann. Die Vorstellung einer irgendwie repräsentativen Auswahl reibt sich auch an der Tatsache wund, dass der Kunstbegriff Jahr um Jahr eine zusätzliche Ausweitung erfährt – und heute niemand mehr staunt, wenn er Physikern oder Köchen, Gärtnern oder Ärzten, Elefanten, Affen oder Hunden begegnet, die in einer Ausstellung Seite an Seite mit herkömmlicheren Künstlern laborieren, operieren, degustieren oder auch bloss exkrementieren.
Das Material, das für eine Präsentation im Rahmen einer Grossausstellung infrage kommt, ist also ganz enorm. So gesehen könnte man sagen, dass die Auswahl einer Biennale deshalb eher der lichte Fleck in einem sonst völlig blinden Gesichtsfeld ist denn umgekehrt.
Woher aber kommt es nun, dass wir trotzdem an der Vorstellung festhalten, eine Biennale sei das Resultat eines allumfassenden Weltblicks, allenfalls mit blindem Fleck?
Als Konsumenten zeitgenössischer Kunst wollen wir dasselbe wie sonst im Leben auch: Wir wollen Erfolg. Und ein erfolgreicher Ausstellungsbesuch ist einer, bei dem wir die Essenz dessen bewältigen, was heute in Sachen Kunst gemacht wird. Wenn wir beim Gang übers Ausstellungsgelände ständig davon ausgehen müssten, dass es dasselbe vielleicht noch besser gäbe – oder anderes, das noch interessanter wäre –, dann würde uns das den Ausstellungsbesuch vollends vermiesen. Wir hätten nicht nur das Gefühl, zweitklassige Kunst anzuschauen – wir würden uns wohl auch selbst zweitklassig fühlen. Kunstbetrachtung ist oft ein gutes Stück Arbeit. Wer sich durch eine Documenta kämpft, der hat ganz schön was geleistet – und wir wollen doch keine Energie auf etwas verschwenden, das sich nicht lohnt.
 |
| David Teniers d. J.: Erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Gallerie in Brüssel Öl auf Kupfer, 106 x 129 cm, circa 1650. Museo Nacional del Prado, Madrid [Beschreibung der Bildtitel] |
Nun könnte man ja sagen, dass eine Biennale oder Documenta dann wenigstens innerhalb des lichten Flecks, aus dem sie sich rekrutiert, sehr ungewöhnlich und überraschend sein muss – und jeweils völlig Neues, völlig Unerwartetes präsentiert. Aber auch das ist regelmässig nicht der Fall – im Gegenteil. Nur warum? Würde jede Grossausstellung ihrem Publikum vorrangig Künstler vorstellen, von denen die meisten Besucher noch nie etwas gehört oder gesehen hätten – und das wäre angesichts der Kunst, die heute produziert wird, problemlos zu schaffen –, dann würde das nicht nur unsere Wahrnehmung völlig überfordern, es würde uns auch mit dem Gedanken belasten, dass wir nie im Leben einen Begriff dieser Welt bekommen können, dass sie sich uns immer und vielleicht sogar mit jedem Tag mehr entzieht. Eine Erfahrung der Ohnmacht, die wir vermeiden würden – dadurch, dass wir solchen Ausstellungen fernblieben.
Ein Knochen für die Sauce
Um erfolgreich zu sein, müssen Documenta und Co. also die Fiktion einer kohärenten, mit dem Medium Ausstellung in ihrer Essenz darstellbaren Welt oder wenigstens Kunstwelt generieren. Das lässt sich teilweise mithilfe theoretischer Diskurse zur Ausstellung leisten, die oft an Welthaltigkeit kaum zu überbieten sind. In der Schau selbst kommt alles auf die richtige Mischung an: Sie muss uns ein wenig Neues oder Halbneues vorführen, damit wir das Gefühl von Frische und Abenteuer erleben – vor allem aber viel Vertrautes oder Halbvertrautes, damit uns die Welt nicht so völlig fremd vorkommt und wir das Gefühl haben, durch unseren Blick, durch unseren Sinn für Kunst, durch unsere Teilnahme auch aktiv an ihrer Gestaltung zu partizipieren. Nur so haben wir das Gefühl eines erfolgreichen Ausstellungsbesuchs.
Es gibt einen Kanon, der ziemlich genau festlegt, was das Filet der Weltkunst ist. Dieser Kanon wird von Kuratoren, Museumsleuten usw. bestimmt – in enger Zusammenarbeit mit professionellen Galerien, denn irgendjemand muss die Sache ja finanzieren, und gerade Arbeiten für Grossausstellungen sind oft nicht ganz billig. Ein einzelner Kurator kann zwar ein Markbein oder ein Stück Herz mit in die Sauce seiner Ausstellung schmeissen, grundsätzlich aber muss das kanonisierte Filetstück erkenntlich bleiben, muss sich der Betrieb in der Ausstellung wiedererkennen können.
Das System funktioniert ziemlich gut – auch ökonomisch, hat die Kunstwelt doch die Krisen der letzten Jahre weitgehend unversehrt überstanden. Ausserdem ist es ja auch jedem freigestellt, sich für die Kutteln der Kunst oder andere sekundäre Teile zu interessieren. Natürlich besteht dann das Risiko, dass man das Filetstück und damit das Essenzielle verpasst und also eindeutig nur einen mehr oder weniger zufälligen Teil der Kunst und der Welt überhaupt mitbekommt. Doch damit lässt sich ganz gut leben, wenn man einmal den befreienden Gedanken gehabt hat, dass es vielleicht nicht nur auf die Kunst selbst ankommt, sondern auch darauf, was wir aus ihr machen. Allerdings muss man schon ein wenig Lust haben, sich aus den Knochen der Kuh sein eigenes Süppchen zu kochen.
Quelle: Samuel Herzog: Die Essenz schlechthin. In: NZZ Nr. 197 vom 25. August 2012
SAMUEL HERZOG studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Denkmalpflege in Basel und Bern. Seit 1994 ist er vollberuflich im Journalismus tätig, seit 2001 betreut er im Feuilleton der NZZ das Ressort Bildende Kunst und erweist sich als »ein Meister der aparten Abschweifung.«
[Sammlung einiger älterer Texte von S.H.]
CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Booklet, Music Samples, Pictures) 13 MB
embedupload ---- MEGA ---- Depositfile --- bigfile
Unpack x197.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the Flac+Cue+Log Files [52:23] 3 parts 231 MB
Reposted on August 25th, 2017