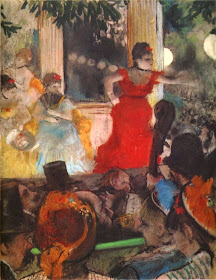Franz Graf von Walsegg, wohnhaft auf Schloss Stuppach am Semmering, wollte seiner im jugendlichen Alter verstorbenen Frau ein angemessenes Denkmal setzen. Zu diesem Zweck bestellte er beim Bildhauer Johann Martin Fischer für mehr als 3000 Gulden ein Grabmonument und bei Mozart für 225 Gulden die Musik für ein Requiem. Der Graf war ein leidenschaftlicher, aber dilettantischer Musiker. Er pflegte sich gerne mit fremden Federn zu schmücken, indem er bei privaten Musikaufführungen Kompositionen anderer als die seinigen ausgab. Auch Mozarts «Requiem» wollte er auf diese Weise darbieten und erteilte deshalb den Kompositionsauftrag anonym über einen Kanzlisten seines Wiener Rechtsanwalts.
Als Mozart im Sommer 1791 den Auftrag erhielt, war er noch mit der Arbeit an zwei Opern («Zauberflöte» und «La clemenza di Tito») und mit der Komposition des «Klarinettenkonzerts» beschäftigt. Er konnte die Arbeit am «Requiem» nicht vor dem 7. Oktober, an dem er die Instrumentation des «Klarinettenkonzerts» abschloss, aufnehmen – zu spät. Als er am 5. Dezember 1791 im Alter von 35 Jahren starb, lagen nur der Eingangssatz und das «Kyrie» vollständig ausgeschrieben vor. Die Stücke der Sequenz «Dies irae» (bis zur Hälfte des «Lacrimosa») sowie das «Offertorium» hatte der schwerkranke Komponist in den wesentlichen Stimmen skizziert.
Um den Auftrag zu erfüllen und den Rest des angezahlten Honorars zu erhalten, liess Constanze das Werkfragment durch Mozarts Schüler und Gehilfen Franz Xaver Süssmayr ergänzen. Süssmayr arbeitete die skizzierten Teile aus, komponierte das «Sanctus», «Benedictus» und «Agnus Dei» hinzu und wiederholte am Schluss den Anfangschor als «Communio». Der Graf führte das Werk am 14. Dezember 1793 gemäss der liturgischen Bestimmung als Totenmesse für seine verstorbene Frau auf, und zwar nach einer eigens angefertigten Partiturabschrift mit der Autorenangabe «Fr.(ançois) C.(omte) de Walsegg». Die Uraufführung des Werkes hatte allerdings schon am 2. Januar 1793 im Rahmen eines Benefizkonzertes zugunsten von Mozarts Witwe stattgefunden.
Quelle: Anonym, im Programmheft des Berner Kammerchors vom April 2014
Gedanken und Eindrücke zum "Requiem", Mozarts einziges Werk mit autobiographischem Bezug
von Nikolaus Harnoncourt
Ich möchte jetzt keine analytischen oder musikwissenschaftlichen Studien zu diesem Werk machen, sondern Eindrücke wiedergeben, die mich beim Erarbeiten von Mozarts "Requiem“ […] als Musiker unmittelbar berührten. Zunächst empfand ich - trotz der fragmentarischen Überlieferung und trotz der vielfach so hart kritisierten Ergänzung durch Mozarts Schüler Süßmayr das Zusammenhängende, den großen Wurf des Ganzen, die Architektur des Gesamtwerks bei weitem zwingender als jemals früher: Die ergänzten Teile kann ich musikalisch keineswegs als Fremdkörper sehen, sie sind im Wesen mozartisch. Es ist für mich völlig abwegig und unmöglich, zu glauben, ein inferiorer Komponist wie Süßmayr, dessen Kompositionen niemals über ein banales Mittelmaß hinausreichen, hätte aus eigenem das Lacrimosa vollenden und dieses Sanctus, Benedictus und Agnus Dei komponieren können. Selbst eine von den anderen Teilen ausstrahlende Inspiration, die Süßmayr gleichsam beflügelt hätte, kann mir die Herkunft dieser Musik nicht glaubhaft machen. Für mich sind diese Sätze eben auch von Mozart, sei es, dass Süßmayr entsprechendes Skizzenmaterial zur Verfügung hatte, sei es, dass ihm diese Kompositionen im Laufe der Zusammenarbeit von Mozart eindringlich vorgespielt worden waren. Auch die deutliche qualitative Diskrepanz zwischen der Komposition und der Süßmayrschen Instrumentation dieser Sätze bestärkt mich in meiner Überzeugung.
Wir wissen aus Mozarts Briefen, dass Gedanken an den Tod und gläubige Auseinandersetzung damit für ihn vertraut und selbstverständlich waren. So schreibt er 1787, also mit 31 Jahren, an seinen kranken Vater: "... da der Tod, genau zu nehmen, der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren, besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel beruhigendes und tröstendes! und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat mir die Gelegenheit zu verschaffen, ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennen zu lernen. Ich lege mich nie zu Bette ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung als ich bin, den andern Tag nicht mehr sehen werde ..."
Schon das Todesquartett aus "Idomeneo", das Mozart zehn Jahre vor dem "Requiem" geschrieben hatte, wirkt auf mich wie eine erste sehr persönliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Mozart, der sich ja mit Idamante identifizierte, hatte zu dieser Oper, besonders aber zu diesem Quartett, zeit seines Lebens eine ungewöhnlich starke emotionale Beziehung. Es ist überliefert, dass es ihn so sehr zu Tränen rührte, dass er nicht weitersingen konnte, als er es gelegentlich in Wien musizierte, wobei er wohl den Idamante sang.
Ähnliches wird uns über eine Art Probe des "Requiems" berichtet, bei der kurz vor seinem Tod die bereits fertigen Teile ausprobiert wurden, wobei Mozart beim Lacrimosa in Tränen ausbrach und nicht mehr weiterkonnte.
Das gesamte Werk wirkt auf mich wie ein zutiefst persönliche Auseinandersetzung; erschreckend und erschütternd bei einem Komponisten, der normalerweise sein persönliches Leben und Erleben geradezu auffallend von seiner Kunst trennte. Das instrumentale Vorspiel ist eine Totenklage (Bassetthörner und Fagotte), zu der die Streicher schluchzend weinen. Diese ruhige Trauer wird aufgerissen durch die Forteschläge der Posaunen, Trompeten und Pauken im siebten Takt: Der Tod ist nicht nur ein milder Freund, sondern der Schritt zum gefürchteten Gericht. Hier empfinde ich zum erstenmal, vielleicht wie Mozart selbst, wie der offizielle liturgische Text zu persönlichster aufwühlender Auseinandersetzung wird: Der Tod trifft jeden einmal - aber was wird mit mir! Oder wie nach "luceat eis" (das Licht soll ihnen ewig leuchten) im Takt 17 bis 20 die inständige allgemeine Bitte in ein beglückendes Trostmotiv mündet, gleichsam: Alles wird gut werden, weil es Erbarmen gibt.
Das Kyrie, die Bitte um das göttliche Erbarmen, steigert sich aus der allgemeinen Fuge in immer persönlichere, geradezu fordernde homophone Rufe: Herr, Du musst mich begnadigen! Besonders stark ist die Gegenüberstellung des Allgemeinen zum Persönlichen in der Sequenz: Das Dies irae malt erbarmungslos die Schrecken des letzten Gerichtstages, die Strenge des Richters ("cuncta stricte discussurus!"), das Tuba mirum, die Erweckung der Toten zum Gericht: nichts blieb ungerächt ("nil inultum remanebit") - rührend persönlich darauf die ängstliche Frage: "Was werde ich Armer dann wohl sagen?"
Oder die krasse Gegenüberstellung des gewaltigen Königs im Rex tremendae mit dem Ich, mit mir: "Rette mich, Quell der Gnade", die im Recordare, einem Satz, der Mozart nach dem Zeugnis Constanzes besonders wichtig war, in ein eindringliches und zutiefst vertrauendes Gebet mündet: "Du hast mich doch durch Dein Leiden erlöst, solche Mühe darf doch nicht vergeblich sein." Ich verstehe die besondere, wohl religiös-musikalische Einstellung Mozarts zu diesem Satz, weil er das Persönliche der Beziehung zu Gott so stark hervortreten lässt, die Möglichkeit der liebevollen Milde des vorher als unerbittlich streng geschilderten Richters innig darstellt, dies besonders an zwei Stellen: "Der Du Maria-Magdalena begnadigt hast, lass auch mich hoffen" (Takt 83-93) und "Lass mich zu deiner Rechten bei den Schafen sein" (Takt 116 - Ende).
Im Confutatis, das von vornherein die Gegenüberstellung: Alle - Ich beinhaltet, wird die innig persönliche Beziehung zu Gott im letzten Satz "Sei bei mir, wenn ich sterbe!" sowohl harmonisch, als auch in einer sicher vertrauensvollen musikalischen Textausdeutung hervorgehoben. Hier höre ich Mozart selbst, für sich selbst sprechen, mit aller ihm zu Gebote stehenden bewegenden Eindringlichkeit, wie ein krankes Kind, das vertrauensvoll seine Mutter ansieht, - und die Angst schwindet.
Quelle: Nikolaus Harnocourt, gefunden im Web in einem Dokument der »Education Group«, Linz
Track 6: Sequenz Nr.4 Recordare
TRACKLIST Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem d-moll KV 626 01. I. Introitus · Requiem (Chor, Sopran) 05:19 02. II. Kyrie (Chor) 02:55 03. III. Sequenz · Nr.1 Dies irae (Chor) 01:53 04. III. Sequenz · Nr.2 Tuba mirum (Sopran, Alt, Tenor, Bass) 03:42 05. III. Sequenz · Nr.3 Rex tremendae (Chor) 02:40 06. III. Sequenz · Nr.4 Recordare (Sopran, Alt, Tenor, Bass)´ 05:51 07. III. Sequenz · Nr.5 Confutatis (Chor) 02:44 08. III. Sequenz · Nr.6 Lacrymosa (Chor) 03:08 09. IV. Offertorium · Nr.1 Domine Jesu (Chor, Sopran, Alt, Tenor, Bass) 04:05 10. IV. Offertorium · Nr.2 Hostias (Chor) 04:34 11. V. Sanctus (Chor) 01:51 12. VI. Benedictus (Chor, Sopran, Alt, Tenor, Bass) 05:56 13. VII. Agnus Dei 02:54 14. VIII. Communio · Lux Aeterna (Chor, Sopran) 06:03 Gesamtspielzeit: 53:14 Irmgard Seefried, Sopran Gertrude Pitzinger, Alt Richard Holm, Tenor Kim Borg, Bass Wiener Staatsopernchor Wiener Symphoniker Eugen Jochum Aufnahme: 1955, Stephansdom, Wien (P) 1956
Ein Amerikaner beginnt zu malen
Die ersten dreißig Jahre des James Abbott McNeill Whistler
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Das Weiße Mädchen: Symphonie in Weiß Nr. I, 1862, Öl auf Leinwand, 214,7 x 108 cm, National Gallery of Art, Sammlung Harris Whittemore, Washington |
James Abbott McNeill Whistler ist in vielerlei Hinsicht ein Vorläufer. Sogar das Stigma des Märtyrers zu tragen, war ihm zu Lebzeiten auferlegt: Mit den Impressionisten teilte er die Zurückweisung durch den Salon und die leidenschaftlichen Angriffe der Kritiker. Späte Anerkennung erfuhr er zunächst im Ausland, Bewunderung aber zollte ihm die intellektuelle Avantgarde seiner Zeit: Zu seinen Freunden zählten Charles Baudelaire und Stephane Mallarmé, Gustave Courbet und Dante Gabriel Rossetti, der Graf Robert de Montesquiou und Oscar Wilde. Seine Nocturnes inspirierten den Musiker Debussy, und Züge seiner Persönlichkeit finden sich in dem Maler Elstir in Marcel Prousts Roman wieder. […]
Whistler wurde [1834] in eine alteingesessene amerikanische Familie schottischer und irischer Abstammung hineingeboren. Sein Vater, George Washington Whistler, war ein überaus erfolgreicher Ingenieur, Absolvent der Militärakademie von West Point, und konnte als Prototyp des kultivierten Yankee-Weltenbummlers gelten. Seine Mutter, Anna Matilda McNeill, war George Washington Whistlers zweite Frau, eine fromme Protestantin aus den Südstaaten. Ihre Bedeutung für Whistlers Leben kommt in dem Umstand zum Ausdruck, daß er ihren Mädchennamen seinem Namen hinzufügte. Durch seine Familie hatte er Anteil an einer provinziellen, militärischen und puritanischen Tradition, von der sein übersteigertes Ehrgefühl, sein ironischer und manchmal frecher Geist sowie die Uberzeugung, einer imaginierten Ritterschaft anzugehören, abzuleiten sind. Das ließ in ihm eine etwas anachronistische, idealisierte Sicht der Welt und der Menschen heranreifen, die sich in seinen Gemälden spiegeln sollte. Er war ein Starrkopf, voll rassischer Vorurteile - die allerdings im Lauf der Zeit schwächer wurden - und trotz vieler Liebschaften ein Frauenfeind. Er kultivierte eine unverschämt perverse Zweideutigkeit und jenen Exhibitionismus, der der Zeit zu eigen war. […]
Er hatte Henri Murgers »Leben der Boheme« gelesen, eine Darstellung des - aus amerikanischer Sicht besonders exotischen - Lebens von Kunststudenten und Arbeiterinnen in Paris, und er beschwor seine Familie ihn ziehen zu lassen. Am 3. November 1855 traf Whistler in Paris ein, mit ganzen 355 Dollars in der Tasche, und nie wieder sollte er den Boden der Vereinigten Staaten betreten.
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Am Klavier, 1858. Öl auf Leinwand, 67 x 91 cm Taft Museum, Cincinnati, Ohio. Legat Louise Taft Sempie |
Der Maler und Essayist Jacques-Emile Blanche - ein mittelmäßiger Maler, aber bemerkenswerter Essayist - erinnert sich im Jahre 1905:
»Unter meinen ältesten Erinnerungen höre ich noch, wie der Name Whistler genannt wird, und zwar von den Leuten, die Fantin-Latour rund um Manet und das Porträt Delacroix' versammelt hat. Ganz hinten im Atelier der Rue des Beaux-Arts war die Hommage à Delacroix zu sehen, auf der sich ein junger Geck, eingezwängt in seinen langen Gehrock, die schwarzen Haare gekräuselt, mit einer weißen Locke auf der Stirn, spöttisch lächelnd, ein Monokel ins Auge kneifend, dem Betrachter zuwendet... Dieser seltsame Mensch beschäftigte mich lange... Der junge Whistler war ein amerikanisches Original ... nach einem glänzenden Einstieg verschwand er rasch von der Bildfläche ... «
Das war ein etwas oberflächliches und voreiliges Urteil. Einige Monate bevor Fantin seine Hommage à Delacroix malte, schrieb Baudelaire in einem nicht signierten Artikel der »Revue anécdotique« vom 2. April 1862, der fünf Monate später im »Boulevard« nachgedruckt wurde:
»Vor kurzem hat ein junger amerikanischer Künstler, Monsieur Whistler, in der Galerie Martinet eine Folge feiner, frisch improvisierter und inspirierter Radierungen ausgestellt, welche die Themseufer darstellen, ein großartiges Gewirr von Tauen, Rahen, Seilen, ein Chaos von Nebel, brennenden Öfen und aufsteigenden Rauchspiralen, die tiefe, verworrene Poesie einer Hauptstadt von gewaltigen Ausmaßen ...«
Whistler trat seinen Aufenthalt in Paris 1855 an. Im Jahr danach schloß er sich dem Atelier Charles Gleyres an, eines Schweizers; der auf wuchtige allegorische und mythologische Szenen spezialisiert war. Obwohl er in der akademischen Tradition malte, war Gleyre ein gefragter Lehrer: Er vermittelte seinen Schülern eine solide Grundlage und ermutigte sie, ihren eigenen persönlichen Stil zu finden. Es wurde eigentlich kein Unterrichtsgeld eingehoben; die Schüler mußten nur für die Miete des Ateliers und die Modelle aufkommen. Auf diese Art wurde Gleyres Schule zu einem Sammelbecken junger und bedürftiger Künstler mit unabhängiger Geisteshaltung.
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Straße in Saverne, 1858 Kupferstich, II/V, 20,8 x 15,7 cm, Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution Washington |
Im Jahre 1858 bringt Whistler die erste Serie von Radierungen heraus, die er auf einer Reise nach Luxemburg, ins Elsaß und ins Rheinland angefertigt hat. Er widmet sie seinem Schwager Seymour Baden, bei dem er anläßlich seiner Englandaufenthalte seine Technik als Graveur vervollkommnet hatte. Er nennt die Serie Zwölf Stiche nach der Natur, sie ist aber auch unter der Bezeichnung Französische Suite bekanntgeworden. Die Stiche erlebten ihren Erstdruck in Paris in der Rue Saint-Jacques bei Auguste Delatre, dem Drucker der Maler von Barbizon, und wurden im nachfolgenden Jahr auch in London ediert. Sie zeigen Landschaftsansichten und lokale Typen; aber auch die bezaubernde Fumette, die »Tigerin« aus dem Quartier Latin (eigentlich hieß sie Héloise), tritt in ihnen auf. […]
Zur selben Zeit machte Whistler die Bekanntschaft Fantin-Latours, der im Louvre Veroneses Hochzeit zu Kana kopierte. Fantin-Latour und Whistler waren beide Bewunderer Courbets, und das brachte sie einander näher. Fantin führte Whistler in die Gruppe der Realisten im Café Moliere ein, von denen einige auf der Hommage à Delacroix zu sehen sind, und interessierte ihn für die Theorien seines Lehrers Lecocq de Boisbaudran über die Schulung des visuellen Gedächtnisses.
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Brücke und Kirche von Chelsea, 1870-1871, Kaltnadelradierung, VI/VI, 10,2 x 16,7 cm, Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution Washington |
In jenem Winter entsteht Whistlers ausgezeichnete Skizze des im Bett überraschten vollständig bekleideten Fantin: der Kälte wegen eingemummt in einen Schal, auf dem Kopf den Zylinder, aber im Begriff zu zeichnen. Ein köstlicher Schnappschuß, von Whistler mit der Legende versehen: »Fantin im Bett liegend, in Verfolgung seiner Studien, unter schwierigen Bedingungen«. Whistler, so vermerkt Léonce Bénédite, bewunderte damals an dem Freund »seine Einfachheit und seine Weite« sowie »die schönen und frischen Farben, die ihm eigen sind«. […]
Im November 1858, als sich Whistler anläßlich einer seiner Londonfahrten bei den Hadens aufhält, überredet er seine Halbschwester Deborah und ihre Tochter Annie, ihm für Am Klavier Modell zu sitzen, sein bislang anspruchsvollstes und bestes Gemälde. Sooft er kam, versuchte ihn die junge Frau an London zu binden, aber er genoß das Pariser Leben viel zu sehr, als daß er darauf eingegangen wäre. Zu jener Zeit ließ sich eine künstlerische Karriere nur in Paris machen. Im Januar 1859 brachte Whistler Am Klavier nach Paris. Es ist ein gut komponiertes Werk und nicht unähnlich den intimen Interieurs Fantins aus derselben Schaffensperiode; man kann es auch mit Degas' Familie Bellelli in Verbindung bringen, die freilich in ihrem völligen Bruch mit den »gestellten« Porträts der klassischen Tradition, in der Haltung der Personen weitaus wagemutiger ist; eine viel stärkere Abbildung des wirklich »Gesehenen«.
Ein anderer Schüler des Meisters des Realismus, François Bonvin, schlug vor, einige der zurückgewiesenen Werke in seinem Atelier in der Rue Saint-Jacques auszustellen, und gewann Courbet zu einem Besuch der Schau. Dieser war ganz besonders vom Beitrag Whistlers angetan, und er beglückwünschte den Schöpfer des Gemäldes auf das wärmste. Die Ausstellung bei Bonvin vermochte eine Anzahl junger Maler in ihren Bann zu ziehen, denen die Abbildung der zeitgenössischen Wirklichkeit kein geringeres Anliegen war als - in ihren subtilen Abstufungen wie in ihren Kontrasten - die Vorherrschaft der Farbe über das graphische Element. Das Interesse, das Courbet an ihm zeigte, machte auf Whistler solchen Eindruck, daß er nach Ornans pilgerte, wo der große Mann aufgewachsen war und die Inspiration zu den meisten seiner Hauptwerke empfangen hatte. Uberwältigt kehrt er zurück, aber die Zurückweisung des Klavier-Gemäldes durch den Salon hatte ihn verbittert (obwohl zwei Zeichnungen angenommen und ausgestellt wurden), und er beschloß Paris zu verlassen. Im Frühjahr 1860 richtete er sich in Rotherhithe, in nächster Nähe der für sein Werk so bedeutsamen Themse, häuslich ein. […]
Als Whistler zusammen mit Fantin-Latour die Jahresausstellung der Royal Academy besuchte, um John Everett Millais' neue Arbeit zu bestaunen, sagte ihm dieser, wie sehr ihm seine Radierungen gefielen. Millais sollte ihm auch gratulieren, als in der Ausstellung des Jahres 1860 Whistlers Am Klavier Aufnahme. fand. Sollte sich London für Whistler als Erfolg entpuppen? Das in Paris abgelehnte Werk wird hier aufs wärmste willkommen geheißen, alle Welt bewundert es, und der Maler John Philip, ein Freund von Millais, kauft es für 30 Pfund. Deborah Haden schätzt sich glücklich, daß ihr Bruder ihrem Rat gefolgt ist, und der junge Amerikaner, dem in Paris die Anerkennung verweigert worden ist, wächst in England zum hochangesehenen Maler heran. […]
Wapping on Thames, begonnen 1860, jenes Gemälde, in dem uns zum ersten Mal Whistlers jüngste Eroberung, sein Modell Joana Hiffernan, eine rothaarige Schönheit aus Irland, begegnet, läßt einen Sinn für Atmosphäre und Licht erkennen, der nicht weit von den Gedankengängen Monets und Frederic Bazilles zur selben Zeit entfernt ist: den Realismus mit der Unmittelbarkeit der Plein-air-Malerei zu verbinden. Die Figuren sind in den Vordergrund hingesetzt, ein auffälliger Pfosten stützt das Balkondach ab, und der Hintergrund gibt den Blick auf den Schiffsverkehr auf der Themse frei.
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Die Rialto-Brücke, 1880, Kupferstich und Kaltnadelradierung, II/II, 29,3 x 20 cm, National Gallery of Art, Washington, Schenkung Mr. und Mrs. J. Watson Webb |
»Die eine, überaus frappierende Parallele zwischen den beiden Gemälden in ihrer visuellen Wirkung ist die: Jeder der beiden Künstler schuf eine merkwürdig einsame Gestalt, die ein wenig eingeebnet scheint und sich vom Hintergrund unangenehm abhebt. Beide Künstler unternahmen eine Gewaltanstrengung, um die Schattierungen des Lichtes einzufangen, das auf einem ganz in Weiß gehüllten Modell spielte.«
Und doch wurde dieses Gemälde, das in der Entwicklung von Whistlers ästhetischem Denken einen Eckstein bildet, für die Ausstellung des Jahres 1862 von der Royal Academy zurückgewiesen.
Auf der Fahrt nach Spanien, wohin es die beiden Liebenden zog, wurde an der baskischen Küste im Südwesten Frankreichs haltgemacht, und Whistler malte dort einige Seestücke voll Kraft und Leidenschaft. In einem Brief an Fantin jedoch schrieb er:
»Du hast entschieden recht, die Freilichtmalerei soll man bei sich zu Hause betreiben ... Da ist ein Augenblick, und schon ist er auf immer entflogen. Man schlägt einen wahren und reinen Ton an, man fängt ihn im Fluge ein, wie man einen Vogel abschießt. Und das Publikum verlangt Vollkommenheit.«
Getrieben wie ein Nomade zog Whistler im März 1863 wieder um, in ein Haus in Chelsea, Lindsey Row 7, in der Nähe der alten Battersea Bridge. Im April fuhr er mit Legros nach Holland, um Rembrandts Radierungen zu studieren. Seine eigenen Radierungen brachten ihm bei einer Ausstellung in Den Haag eine Goldmedaille ein. In Paris unterbrach er die Reise, um seine Freunde wiederzusehen, aber er war mittlerweile zum Londoner geworden. Er verkehrte in den Kreisen der Präraffaeliten, mit Rossetti, Burne-Jones, William Morris und dem Dichter Swinburne, den er Manet vorstellte, er zeigte sich in den Klubs und Salons, hofierte die Damen und weckte den Neid der Snobs, indem er chinesisches Porzellan und japanische Holzschnitte sammelte, welche Mode er in London einführte. Auch durch seine ausgefallene Kleidung, seine spitzen Bemerkungen, seine Lausbubenstreiche und seinen eigenwilligen Geschmack begann er auf sich aufmerksam zu machen.
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Das kleine weiße Mädchen: Symphonie in Weiß Nr. II, 1864, Öl auf Leinwand, 76,5 x 51,5 cm, Tate Gallery, London. |
Dem Weißen Mädchen wird der Eintritt in den Salon von 1863 ebenso verwehrt wie dem Frühstück im Freien von Manet. Es ist nicht das erste Mal, daß die Jury eine solche Feindseligkeit gegenüber der modernen Malerei an den Tag legt; aber dieses Jahr ist die Anzahl der abgewiesenen Werke außergewöhnlich hoch, und die Künstler sind wütend. Die Proteste sind so heftig, daß Napoleon III., »von dem Wunsche beseelt, die Öffentlichkeit über die Berechtigung dieser Klagen selbst befinden zu lassen«, die Ausstellung der nicht zugelassenen Werke anordnet. 781 Gemälde sind in diesem »Salon des Refusés« zu sehen, darunter Werke von Fantin-Latour, Bracquemond, Henri Harpignies, Johan Barthold Jongkind, Camille Pissarro, Legros, Manet und Whistler. Unter den im Katalog nicht genannten Malern befindet sich auch ein Unbekannter namens Paul Cézanne.
Manet und Whistler sind das Gespött des Publikums, beide aus denselben Gründen: Nachlässige Ausführung, »Gemeinheit« des Gegenstandes, Mittelmäßigkeit des Entwurfs, Mißachtung der Ordnung der verschiedenen Ebenen wird beiden ebenso vorgeworfen wie ein Gebrauch der Farbe, der - anstatt die Formen zu konturieren - die Flächigkeit noch unterstreicht.
Die Weiße Dame (so die Bezeichnung im Katalog), die besonders schlecht aufgenommen wurde, war mit Absicht in die Nähe eines der Ausgänge gehängt worden, so daß sie nicht zu übersehen war. Zola erzählt in seinem Buch »L'Œuvre«, wie »die Leute einander anstießen, sich vor Lachen bogen und sich vor dem Bild beständig Gruppen bildeten, die sich das Maul zerrissen«. Zusammen mit dem Frühstück im Grünen ist Whistlers Beitrag in der Tat der große Heiterkeitserfolg, aber auch Hauptgegenstand von Ekel und Entsetzen, außer für Baudelaire, der das Bild, wie einem Brief Fantins an Whistler nach Amsterdam zu entnehmen ist, »bezaubernd, absolut exquisit« findet: »Legros, Manet, Bracquemond, De Balleroy und ich glauben, daß es ein sehr gutes Bild ist«, schreibt Fantin. »Wir finden die Weißtöne superb, und aus der Entfernung (das ist die wahre Probe aufs Exempel) sehen sie erstklassig aus. Courbet nennt Dein Bild eine Offenbarung ...«
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Palais, Brüssel, 1887, Kupferstich und Kaltnadelradierung, I/II, 21,7 x 13,8 cm, National Gallery of Art, Washington, Sammlung Rosenwald |
Paul Mantz und Ernest Chesneau waren von Manets Frühstück verstört (Mantz hielt es für krankhaft), schätzten aber den Beitrag Whistlers. Chesneau rühmte an ihm etwas, das er »eine romantische Vorstellung von Traum und Poesie« nannte. Whistler hätte ihm dasselbe antworten können, was er zuvor schon einem Londoner Kritiker entgegengehalten hatte: »Mein Gemälde stellt nur eine weißgekleidete Frau dar, die vor einem weißen Vorhang steht.«
Das Weiße Mädchen wird von vielen als eine etwas konstruiert wirkende Wiederkehr der Romantik angesehen, als Übergang vom Naturalismus zum Symbolismus, vor allem aber als eine glänzende malerische Leistung, die Bewunderung verdient. Mantz hat die Zugehörigkeit des Gemäldes zu einer französischen Tradition der Erprobung von Weiß-auf-Weiß-Wirkungen konstatiert, aber Whistler verband sie mit anderen Absichten wie etwa der Einführung der präraffaelitischen Femme fatale, und er schuf ein Gemälde mit rätselhaften und zauberischen Zügen. Hier setzt eine neue, zunehmend subjektive Einstellung gegenüber der Natur ein, eine Art halluzinatorischen Ästhetizismus, der die Schriftsteller und Dichter in seinen Bann ziehen sollte. Offenkundig näherte sich Whistler der als »imaginativ« bezeichneten Position Baudelaires an (als Gegenpol zur »positivistischen«); einer traumartigen Auffassung von Gegenständen, die dem Alltag entnommen werden. Whistlers Wirklichkeit steht dem Traum näher als dem Leben.
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Harmonie in Blau und Silber: Trouville, 1865, Öl auf Leinwand, 50 x 76 cm, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston |
Whistlers Haus in Chelsea war bald mit orientalischen Gemälden, Stichen, Möbeln, Fächern und Porzellan angefüllt. Seine Mutter, die der Bürgerkrieg aus den Vereinigten Staaten vertrieben hatte, nahm bei ihm dauernden Aufenthalt. Sein Haus wurde zum bevorzugten Treffpunkt von Künstlern, Literaten, Dichtern, Musikern, Sammlern und anderen Ästheten aus Paris und London. So begann die betrübliche Konfusion von Whistler als Künstler und Whistler als schillernder Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. […]
Als in der Jahresausstellung der Royal Academy von 1864 sein Landschaftsbild Wapping on Thames gezeigt wurde, schrieb der Kritiker der »Times«: »Wenn Velásquez unseren Fluß gemalt hätte, so hätte er es auf diese Art tun müssen.« Das war gewiß ein Kompliment, aber von der Intensität eines Keulenschlags, von dem man sich nicht leicht wieder erholt. Ein ähnlicher Triumph ereilte im Jahr danach Das kleine Weiße Mädchen, das auch Symphonie in Weiß Nr. 2 genannt werden sollte. Den Dichter Swinburne inspirierte es zu dem Gedicht »Vor dem Spiegel«, aus dem Whistler zwei Zeilen entnahm, um sie als Inschrift auf dem Rahmen anzubringen:
Entfallne Rose, liegt meine Hand
schneeweiß auf weißem Schnee und sorgt sich nicht.
[…]
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Meer und Regen, 1865, Öl auf Leinwand, 50,7 x 72,6 cm, University of Michigan Museum of Art, Legat Margaret Watson Parker |
Im Herbst 1865 sind Whistler und Jo in Trouville, dem fashionablen Seebad, wo Courbet, umgeben von einem Publikum titelbehängter Feriengäste und von diesen betörter schöner Frauen, »die Natur in ihrer Natürlichkeit« malt. Courbet ist für die fremdartigen Reize der schönen Irin nicht unempfänglich. Der Amerikaner und der Franzose aus der Franche-Comté malen gemeinsam Seestücke; dieser schreibt recht herablassend an seinen Vater: »Der Maler Whistler ist hier mit mir, er ist ein Engländer (sic!), der mein Schüler ist«, und malt zwei Porträts der schönen Jo.
Die Weite, der helle graue Himmel und das Wechselspiel von Licht und Schatten sind für Whistler eine Quelle neuer Anregungen. Seine mit breiten horizontalen Pinselstrichen auf die Leinwand gebrachten Seelandschaften unterscheiden sich von der späteren Sichtweise der Impressionisten sehr stark, aber andererseits nehmen sie durch die Breite der Perspektive und durch die Bedeutung, die sie fern aller Künstlichkeit und allen Schnörkeln dem Licht beimessen, den Impressionismus vorweg. Degas bewundert sie; sie sind, wie er sich über seine eigenen Landschaften ausdrückt, »Zustände des Auges«.
Whistler schafft eine Folge von vier außergewöhnlichen Seestücken, von denen das erste, Harmonie in Blau und Silber, Trouville, im Vordergrund eine kleine Figur zeigt, die ohne Zweifel Courbet darstellt. Der Maler steht am Ufer und blickt auf die See hinaus, so wie sich Courbet 1854 in seinem Gemälde Künstler, das Mittelmeer grüßend selbst abgebildet hat. Mit der Woge (Montclair Art Museum, New Jersey), mit Trouville (Art Institute, Chicago) und Meer und Regen zählt es zu den zartesten und stärksten Impressionen dieser fast winterlichen Begegnung Whistlers mit dem unermeßlichen Meer. Courbets Einfluß macht sich vor allem im rauschenden Rhythmus, in der Bewegung und in der synthetischen Auffassung des Raumes bemerkbar. Das war schon in den beiden schönen Landschaften zu erkennen, die er im Jahr zuvor gemalt hatte, in Chelsea im Winter (Privatbesitz, Großbritannien) und in Battersea, Ansicht von Lindsey House aus (Hunterian Museum, Glasgow). Man verspürt in ihnen den Hauch des Fernen Ostens, und zwar durch die Verkürzung der Tiefendimension und durch subtile Abstufungen in der Wirkung der Atmosphäre, die der Harmonie neutraler Farbtöne zu verdanken sind. Den Vordergrund des Battersea-Bildes nehmen drei Gestalten mit japanischen Zügen ein, die wie eine Leiter in diese Landschaft hineinführen, die in Nebel- und Wasserschleiern versinkt.
 |
| James Abbott McNeill Whistler: Wapping on Thames, 1861-1864, Öl auf Leinwand, 72,3 x 102,2 cm, National Gallery of Art, Washington, Sammlung John Hay Whitney. |
Das Meer, die Flüsse, die Häfen, die Schiffe - die Symbole des Nomadenturns, die »andern Orte«, die Baudelaire feierte - haben Whistler zeitlebens inspiriert. Gleich nach seiner Ankunft in London hat er sich für einen Wohnsitz in Chelsea entschieden, weil ihn das Volksleben in den Docks und die kleinen Straßen, die zur Themse hinunterführen und die er in zahllosen Veduten verewigen sollte, unwiderstehlich anzogen. Er hielt aber mit seinem Mißtrauen gegenüber der Natur nicht hinterm Berg; wir erinnern uns jener Formulierung in dem Brief an Fantin-Latour, wonach man »die Plein-air-Malerei bei sich zu Hause praktizieren« solle. Für Whistler war eine Landschaft nur eine Sinneswahrnehmung, und anders als Courbet und die Impressionisten sollte er der von ihm abgebildeten Natur niemals eine überragende Bedeutung beimessen. […]
Die Natur, welche die Impressionisten mit solcher Hingabe an Ort und Stelle beobachteten und studierten, war das Licht selbst; Whistler hingegen interessierten bloß die Wirkungen, die dieses Licht hervorrief - der Nebel, der Regen, das verhangene Licht der Sonne, Arrangements, Symphonien, Harmonien und Variationen. […]
Trotz dieser Bewegung weg vom Realismus kehrte Whistler der Natur niemals den Rücken zu, und sein Verhalten und seine Wortmeldungen zur Plein-air-Malerei sollten im übrigen stets voller Widersprüche bleiben. Um es mit den Worten Katharine Lochnans zu sagen:
»Er wies den Realismus für eine Kunst, die zwar auf der Natur gründete, aber von Schönheit, Vorstellungskraft und künstlerischem Temperament bestimmt war, zurück. Er hatte begonnen, seine Kompositionen und Farbzusammenstellungen im Kopf auszuformulieren.«
Quelle: Pierre Cabanne: Whistler. [Übersetzt von Wolfgang Bahr] Gondrom, Bindlach 1993, ISBN 3-8112-1042-4. Auszüge aus den Seiten 5 bis 43
CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Booklet, Music Samples, Pictures) 46 MB
embedupload ---- MEGA ---- Depositfile --- bigfile
Unpack x228.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the Flac+Cue+Log Files [53:14] 3 parts 226 MB
Reposted on June 2nd, 2017