Die bitter-arme Jugend Dvoraks, seine musikalischen Anfänge in der Dorfschule und Dorfkirche, die Jahre in der Orgelschule Prag mit den ersten Gehversuchen in einer 20 Mann starken Tanzkapelle – all dies lebt in seiner Musik fort, in den scheinbar so naiv mitreißenden Themen seiner Kammermusik ebenso wie in den süßen Melodien seiner Lieder. In den abgeklärten späten Streicherwerken hören wir immer noch den Dvorak, der in einer Prager Irrenanstalt zum ersten Mal Streichsextette spielte, im Dumky-Trio den jugendlichen Dorfmusikanten, der sich an der jährlichen großen Messe zum Kirchweihfest erfreute und bei Mozart, Haydn und Cherubini in die Lehre ging. Dvorak vertraute stets darauf, der liebe Gott werde ihm “schon auch einige Melodien zuflüstern”. Doch dieser göttliche Funke wehte ihn oft genug mitten in der Härte des Lebens an.
Klaviertrio Nr. 4 e-Moll, op. 90 (Dumky)
Dvoraks beliebtestes Werk für Violine, Violoncello und Klavier ist zwar der Besetzung, nicht aber der Form nach ein klassisches Klaviertrio. Dvorak selbst nannte es - als er es 1891, acht Jahre nach seinem f-Moll-Trio, veröffentlichte, - ganz bewusst nicht “Klaviertrio Nr. 4”, sondern schlicht Dumky. Man könnte diesen Titel in Analogie zu den Slawischen Tänzen mit “Ukrainische Tänze” übersetzen, denn das Trio besteht aus nichts anderem als aus sechs aufeinanderfolgenden Dumkas. Die Dumka ist ein ursprünglich aus der Ukraine stammender Tanz, sein Merkmal der zweimalige Wechsel zwischen “langsam-schwermütigen und schnell-ausgelassenen Charakteren” (Ludwig Finscher). Auf diesem Prinzip beruht jeder der sechs Sätze in Dvoraks Opus 90, mit der Besonderheit, dass die ersten drei Dumky attacca ineinander übergehen, also eine Art zusammenhängenden Kopfsatz mit langsamer Einleitung bilden. Nach einer kleinen Pause folgen die beiden separaten Mittelsätze, quasi langsamer Satz und Scherzo , schließlich das Finale. Trotz der scheinbar losen Reihung von Tänzen wird also subkutan doch wieder die Form eines “ernsthaften, viersätzigen Stücks”, wie Brahms es nannte, suggeriert.
Auch in der Tonartenfolge scheint das Werk nicht geschlossen und dennoch zyklisch zusammenhängend. Die erste Dumka steht in e-, die letzte in c-Moll, dazwischen führt ein subtiler Modulationsweg zunächst über cis-Moll nach A-Dur, dann über d-Moll und Es-Dur nach c. Keiner der Sätze weist eine Durchführung auf; thematisch-motivische Arbeit im Sinne Beethovens fehlt völlig, und auch im Klang dominiert ein flächiges Musizieren, das oft gerade das Cello als primus inter pares hervortreten lässt. Gerade in dieser Dominanz des puren Klangs, der sich mal in ausdrucksvoll-getragenen Kantilenen, mal in tänzerisch-vitalen Eruptionen bekundet, liegt die Ursache für den Erfolg, der dem Werk seit der Uraufführung im April 1891 treu geblieben ist.
Klaviertrio Nr. 3 f-Moll, Op. 65
Obwohl Antonin Dvorák kein begnadeter Klaviervirtuose, sondern von Hause aus Organist und Streicher war, hat er seine Kammermusik mit Klavier doch im Konzertsaal aufgeführt. Mit dem Geiger Ferdinand Lachner und dem Cellisten Alois Neruda (später mit Hanus Wihan, dem Widmungsträger seines Cellokonzerts) bildete er ein festes Klaviertrio, das unter anderem im Oktober 1883 sein f-Moll-Klaviertrio, op. 65, aus der Taufe hob. Das längste und dramatischste seiner vier Klaviertrios ist “in jeder Hinsicht ein Ausnahmewerk, in seinem gespannten und bis fast zum Ende düsteren Ton, seiner Kompliziertheit und nicht zuletzt seiner ungewöhnlichen Ausdehnung auf fast 40 Minuten Spieldauer.” (Ludwig Finscher)
Die Komposition des f-Moll-Trios nahm Dvorák ungewöhnlich lange - länger als zwei Monate - in Anspruch (für gewöhnlich schloß er ein ganzes Kammermusikwerk in wenigen Tagen ab). Das Werk bezeichnet eine Wende in seiner Stilentwicklung. Er wandte sich hier von seiner sogenannten “slawischen Phase” ab und dem großen Vorbild Brahms zu. Die Entwicklung der Themen aus kleinsten Motivbausteinen, die großen dramatischen Steigerungen und der düstere Ton erinnern unmittelbar an bestimmte Kammermusiken von Brahms, etwa an das f-Moll-Klavierquintett oder an die Klavierquartette. Daneben gibt es immer noch deutliche Anklänge an die tschechische Folklore, sie bestimmen aber nicht mehr den Ausdruck der vier Sätze, sondern geben ihnen lediglich eine nationale Färbung.
Klaviertrio Nr. 2 g-Moll, op. 26
Die beiden frühen Trios in B und g, Opera 21 und 26, sind selten zu hören. Sie stammen aus jener Periode stilistischen Wandels, in der Dvoraks Konsolidierung unter dem Einfluss von Brahms noch nicht abgeschlossen, seine Neigungen zur Liszt-Wagnerschen Seite noch nicht gänzlich vergessen waren. Dies verleiht den Werken jener Jahre um 1875 - neben den beiden Ttrios waren es das Klavierkonzert, die 4. Sinfonie und das Stabat mater - einen eigenwilligen Zug ins Ausufernd-Romantische. Im g-Moll-Trio von 1876 offenbart dies besonders der Kopfsatz, der mit seinen 12 Minuten Länge und dem gleichsam vagierenden Hauptthema den Grundton des Werkes bestimmt.
Klavierquartett Nr. 1 D-Dur, op. 23
Wenn Dvorak bei Mozart davon sprach, es sei alles “so schön komponiert”, so nahm dieses Verlangen nach absoluter Schönheit in seiner eigenen Musik oft genug einen Zug zum schier endlosen Sich-Aussingen an. Eine volkstümliche Wendung folgt auf die nächste, im Klang und in der weich-schillernden Harmonik sich stetig steigernd. Ganz so ist der erste Satz des D-Dur-Klavierquartetts, op. 23, angelegt. Das so unscheinbar daherkommende Cellothema, das von der Violine sanft nach Moll abschattiert und vom Klavier in hellsten Klang getaucht wird, lässt kaum vermuten, dass es als Material für einen viertelstündigen Sonatensatz dient. Nach der rhythmisch kraftvollen ersten Überleitung kehrt das Thema bereits gesteigert wieder, und auch im weiteren Satzverlauf bleibt es stets präsent: als motivischer Anklang, als Brücke zur nächsten großen Steigerung. Von ähnlich lyrisch-volkstümlichem Zuschnitt wie das Haupt- ist auch das Seitenthema, das alsbald in einen typischen Dvorak-Klang gehüllt wird und sich schier endlos-singend in immer wieder neuem Anlauf steigert. Die motivisch-thematische Arbeit und die durchaus romantisch-auftrumpfenden Höhepunkte dieses Satzes treten gegenüber den Momenten lyrischen Verweilens zurück.
Klavierquartett Nr. 2 Es-Dur, op. 87
Antonin Dvoraks Es-Dur-Klavierquartett gehört zu seinen bedeutendsten Kompositionen, wenn auch zu den selten aufgeführten. Nach seinem ersten Klavierquartett von 1875 (D-Dur, op. 23) hatte Dvorak fast 15 Jahre gewartet, bis er ein zweites in Angriff nahm, obwohl ihn sein Verleger Fritz Simrock immer wieder zu einem neuen Werk dieser Gattung gedrängt hatte. Die drei Klavierquartette von Brahms, die bei Simrock erschienen waren, hatten sich als Erfolg erwiesen, und nun erhoffte sich der Verleger Ähnliches von dem einzigen Komponisten, dessen Kammermusik die Qualität eines Brahms erreichte. Dvorak fand erst im Sommer 1889 Zeit, den Wünschen Simrocks nachzukommen, vielleicht auch, weil er sich selbst an dem hohen Standard der Brahmsschen Quartette maß. Es gibt zahlreiche Querverbindungen zwischen seinem Quartett und denen seines deutschen Kollegen, besonders zwischen dem langsamen Satz und den Adagios aus Brahms’ Opera 26 und 60.
Nach der Uraufführung 1890 wurde bald deutlich, daß Dvoraks Klavierquartett den Vergleich mit den Brahmsschen nicht zu scheuen brauchte: es ist ein eigenständiges Werk, in mehrfacher Hinsicht ein Klavierquartett sui generis. So enthält es ungewöhnliche ätherische Klangbilder, in denen der Klavier- mit dem Streicherklang vollendet verschmilzt. Im Streichtrio wird die Violine fast an den Rand gedrängt, so prominent sind Bratsche und Cello behandelt. Die Tonart Es-Dur ist alles andere als tonangebend. Schon von den ersten Takten an wird sie nach Moll verdunkelt; der tonale Bogen spannt sich durch die für Dvorak typischen chromatischen Modulationen bis zu Tonarten wie G-Dur, Ges-Dur (Lento) oder H-Dur (Trio). Die Ecksätze sind Musterbeispiele für jene Kunst thematischer Metamorphose, die man aus Dvoraks Sinfonien kennt.
Klavierquintett Nr. 1 A Dur, op. 5
Dass Antonin Dvorak zwei Klavierquintette in der gleichen Tonart, in A-Dur, geschrieben hat, ist kein Zufall, sondern eine Laune der Geschichte. Als ihn sein Verleger Fritz Simrock 1887 bat, sein altes Klavierquintett Opus 5 für eine Neuauflage zu überarbeiten, konnte Dvorak das Stück in seinem Notenschrank nicht finden und entschloss sich kurzerhand, ein neues Quintett in der gleichen Besetzung und Tonart zu komponieren. Einer anderen Version der Geschichte zufolge, fand er sehr wohl das alte Manuskript, fand es aber so unbefriedigend, dass er sich statt zur Revision zur Neukomposition entschloss. So kam es zu dem großen Quintett Opus 81, das seitdem den frühen Vorläufer nahezu vollständig aus den Konzertsälen verdrängt hat.
Bis auf wenige herausragende Interpreten - darunter Svjatoslav Richter und das Borodin Quartett - hat sich kaum eine Formation dieses Frühwerks angenommen, zumal erst 1962 der Musikwissenschaftler John Clapham eine kritische Ausgabe der Erstfassung vorlegte. Dvorak hatte das Stück nämlich 1877 um nahezu 200 Takte gekürzt, den ersten Satz seines zweiten Themas und das Adagio einiger besonders schöner Stellen beraubt. Gerade in der ungekürzten Urfassung aber offenbart es den durchaus rauen Charme des jungen Dvorak am Beginn seiner Kammermusik, eine von Brahmsschen Skrupeln noch freie Experimentierfreude - sehr wohl umständlicher als im reifen Gegenstück, aber nichtsdestoweniger einnehmend.
Klavierquintett Nr. 2 A Dur, op. 81
Bis heute ist es eines der meistgespielten des Komponisten, denn es repräsentiert das Paradigma seiner Kammermusik: reiche melodische Erfindung, üppiger Klang, meisterliche Form, Volkstümlichkeit neben spätromantischem Pathos, tschechische Einflüsse, die sich in den Titeln der Mittelsätze niederschlagen. Nahtlos reiht sich das Quintett in die große Reihe romantischer Klavierquintette von Schubert, Schumann, Brahms und Franck ein, die Höhepunkte im Schaffen ihrer Komponisten bilden; so auch bei Dvorak.
Dessen Quintett wirkt wie der Versuch einer Synthese aus dem naiv strömenden Lyrismus des Forellenquintetts und dem symphonischen Charakter des Brahms-Quintetts. Gleich der Beginn des 1. Satzes – einer der bezaubernsten Einstiege der gesamten Kammermusik – stellt ein Schubertisches Cellothema einem symphonischen Tutti nach dem Vorbild von Brahms gegenüber. Ihm folgen: ein leggiero-Thema in a-Moll, ein der Bratsche zugewiesenes, wehmütiges Seitenthema in cis-Moll und eine aus diesem abgeleitete Schlussgruppe. Die Themen werden in einer Sonatenform von monumentalen Ausmaßen verarbeitet, wobei ein Zitat aus dem A-Dur-Kavierquartett von Brahms auf das Vorbild dieses Satzes verweist. Besonders hervorzuheben sind die harmonischen Ausweichungen in der Durchführung, die bis nach es-Moll und Ces-Dur führen, und die großartig gesteigerte Reprise des Hauptthemas.
Streichquintett G Dur, op. 77
Antonin Dvorak hat drei Streichquintette geschrieben, die alle drei an charakteristischen Punkten seiner Karriere stehen: das a-Moll-Quintett von 1861 war sein Opus 1, das G-Dur-Quintett von 1875 das erste mit einem Kompositionspreis ausgezeichnete Stück, das Es-Dur-Quintett von 1893 eines der amerikanischen Spätwerke im Umkreis der Sinfonie aus der Neuen Welt.
Nur für das G-Dur-Werk wählte er die Besetzung mit Streichquartett und Kontrabaß, die zwar seltener ist als die Quintettbesetzungen mit zwei Celli bzw. zwei Bratschen, die aber dennoch seit dem späten 18. Jahrhundert zu den geläufigen Varianten des Streichquintetts zählte. Dem jungen Dvorak ging es offenbar darum, ein Streichquartett mit zusätzlichem Baßfundament zu schreibe, eine Art solistischer Streichersinfonie, als die man sein G-Dur-Quintett auffassen kann. Er komponierte es zur gleichen Zeit wie die 5. Sinfonie und die Serenade für Streichorchester; außerdem bearbeitete er den fünften Satz des Werkes, der vor der Drucklegung gestrichen wurde, für Streichorchester (Notturno H-Dur, op. 40). Daran kann man seine Absichten ablesen.
In der erst 1888 als Opus 77 gedruckten viersätzigen Fassung stellt sich das Werk als ganz traditionelles Kammermusikstück aus Sonatenallegro, Scherzo, Adagio und Rondofinale dar. Doch schon der erste Satz sprengt den kammermusikalischen Rahmen in orchestraler Weise. Er ist fast vollständig aus dem Motiv der Einleitung entwickelt, das im Stil einer sinfonischen Dichtung leitmotivisch verwendet wird. Nicht zufällig erinnern die Harmonik und der “Orchester”-Satz häufig an Wagner und Liszt, von deren Einfluß sich Dvorak 1875 noch nicht gelöst hatte. Andererseits werden erstes und zweites Thema in betont einfacher Weise vorgestellt, “im Volkston”, den Dvorak in diesem Werk besonders betont hat.
Streichquintett Es Dur, op. 97
Dvoraks Streichquintett Es-Dur ist ein künstlerisches Ergebnis seiner, durch die 9. Sinfonie berühmt gewordenen Reise “in die Neue Welt”. Aus derselben klangen seine musikalischen Botschaften nicht nur nach Europa herüber; sie lösten auch ein in der amerikanischen Öffentlichkeit damals vieldiskutiertes Problem: die Frage nach einer nationalen Musik der Vielvölkergemeinschaft USA. Der Tscheche Dvorak war – als prominentester Vertreter der Nationalschulen Osteuropas – ganz bewußt nach New York eingeladen worden, um den Amerikanern den Weg zu einer eigenen Nationalmusik zu weisen. Dvorak nahm sich des Problems zunächst theoretisch an; in Zeitungsartikeln plädierte er für die Melodien der Schwarzen und Indianer als Quellen einer authentisch “amerikanischen” Musik. Den praktischen Beweis erbrachte er im Dezember 1893 mit der Sinfonie Aus der Neuen Welt. Sie traf jenen authentischen Ton, den Publikum und Kritik sehnsüchtig erwartet hatten, und wurde sogleich zur “amerikanischen” Sinfonie erklärt.
Der Wiener Kritiker und Brahms-Freund Eduard Hanslick fand für diesen Titel folgende Erklärung, die auch die kammermusikalischen Schwesterwerke der Sinfonie mit einbezieht, das sog. “Amerikanische Streichquartett” und das Es-Dur-Streichquintett: “Was wir ganz allgemein amerikanische Musik nennen, sind eigentlich importierte schottische und irische Volksweisen, nebst etlichen Negermelodien. In der E-Moll-Symphonie ist dieser Typus nicht so stark ausgeprägt wie in den oben genannten Kammermusikwerken, aber man wird doch sofort Motive heraushören, die von Dvoraks früherer Arbeit weit abstehen, wirklich, wie der Titel besagt, aus einer andern Welt sind.”
“Aus einer andern Welt” ist im Falle der zwei Kammermusikstücke der ätherische Klang. Er erweckt, zusammen mit den pentatonischen Melodien, den Eindruck einer spontanen, unverbrauchten Musik, die den Blick zugleich wehmütig in die Ferne schweifen läßt. Die Inspirationsquelle dafür fand Dvorak im Sommer 1893 in der tschechischen Siedlung Spillville in Iowa, einer jener Enklaven, die sich euroäische Einwanderer in Amerika schufen, um die Kultur ihrer Heimat zu bewahren. In dem vertrauten, mit Volksmusik gesättigten Milieu des Ortes entstand in nur einem Monat, zwischen dem 1. 7. und 1. 8. 1893, das Es-Dur-Streichquintett.
Violinsonate F-Dur, op. 57
Gemessen an ihrem Umfang und ihrer Bedeutung fristet Dvoraks einzige Violinsonate im Konzertleben ein Schattendasein. Sie ist weit weniger bekannt als seine Sonatine Opus 100 und das Violinkonzert, obwohl sie beiden an kompositorischer Qualität in nichts nachsteht. Zum Violinkonzert bildet sie insofern ein kammermusikalisches Gegenstück, als sie kurz vor dessen umfassender Revision entstand. Im März 1880, wenige Monate, bevor Smetana „Aus der Heimat“ komponierte, schrieb Dvorak in gewohnter Schnelligkeit die Sonate nieder. Im Vergleich zur freien Formgebung seines Antipoden blieb er der klassisch-romantischen Sonatenform treu und erfüllte sie - deutlich unter dem Einfluss von Brahms - mit spätromantischem Inhalt.
Sonatine G-Dur für Violine (Violoncello) und Klavier, op. 100
Mit dem Amerikanischen Streichquartett, op. 96, dem Streichquintett, op. 97, und der Sonatine für Violine und Klavier, op. 100, schuf Dvorak eine kammermusikalische Trias von entrückter Klangschönheit und zartetester Hommage an die “Nationalmusik” Amerikas. Letztere suchte der von Mrs Thurber, der gestrengen Direktorin des New Yorker Konservatoriums, an den Hudson River Beorderte in der Musik der Opfer des amerikanischen Traums: bei den Indianern und Negersklaven. Denn Mrs Thurbers idealistische Vorstellung von der “Nationalmusik”, die Dvorak für die große amerikanische Nation erfinden solle, hatte vor der Realität eines Einwanderer-Landes kaum Bestand. Und so nahm Dvorak Zuflucht zu zwei authentischen Folklore-Eindrücken, die sich ihm gleich nach der Ankunft in New York einprägten: die Tänze von Irokesen, die er in den Shows des Buffalo Bill zu sehen bekam, und die Spirituals, die ihm ein farbiger Schüler am Koservatorium vorsang.
Noch vieles andere ist in die amerikanischen Werke eingeflossen: Die Erzählungen alter Auswanderer über die harten Anfangsjahre in Amerika, die Großmütterchen in der Dorfkirche von Spillville in Iowa, wo Dvorak den Sommer 1893 verbrachte und die Gemeinde an der Orgel mit tschechischen Kirchenliedern überraschte; das Erlebnis der amerikanischen Natur, die Dvorak schon auf der 36stündigen Bahnfahrt von New York nach Iowa in ihren Bann gezogen hatte, und seine Morgenspaziergänge am Turkey River, einem Nebenfluss des Mississippi.
Getrost dürfen die geneigten Hörerinnen und Hörer Spuren dieser Reiseeindrücke auch in der Sonatine wiederfinden, die Dvorak in der Vorweihnachtszeit 1893 in New York für seine Kinder geschrieben hat. Es waren die 15jährige Otilie und der 10jährige Anton, die sie zuerst spielten, doch nicht nur für die Jugend, sondern auch “für Große, Erwachsene” wollte der Komponist das Werk verstanden wissen. “Sie sollen sich damit unterhalten, wie sie eben können.”
Romantische Stücke für Violine und Klavier, op. 75
“Sie sind freilich mehr für Dilettanten gedacht, aber hat Beethoven und Schumann auch nicht einmal mit ganz kleinen Mitteln geschrieben und wie?” Eher stolz als rechtfertigend klingen die Sätze, mit denen Dvorak im Januar 1887 seinem Verleger Simrock die vier „Romantischen Stücke für Violine und Klavier“ ankündigte. Ursprünglich handelt es sich dabei um einen Zyklus, den er unter dem Titel Drobnosti (Kleinigkeiten) für das ungewöhnliche Streichtrio aus zwei Geigen und Bratsche geschrieben, aber sogleich für die verkaufsträchtigere Besetzung Violine und Klavier umgearbeitet hatte. Nach einer ersten Aufführung mit dem Geiger Karel Ondricek in Prag meldete der Komponist seinem Verleger: “Gestern hier gespielt und sehr gefallen.”
Serenade d-Moll für 10 Bläser, Violoncello und Kontrabass, op. 44
Wenn spätromantische Komponisten zur Gattung der Serenade griffen, handelte es sich meist um einen Atavismus, d. h. um eine bewusste Rückentartung in die Welt der Wiener Klassik hinein. Die Bewunderung für die zwischen Unterhaltungs- und Kunstmusik schwerelos die Waage haltenden Serenaden Mozarts und Haydns war um 1850 bereits ein Bekenntnis zur “Alten Musik”. Selbst Hauptwerke dieses Repertoires waren damals längst aus dem Konzertsaal verschwunden und mussten von Bläservereinigungen und philharmonischen Orchestern erst “wiederentdeckt” werden. In der Begegnung mit diesen so lange vergessenen Werken entdeckten die Komponisten der Zeit ihre Liebe zur Serenade, so auch der junge Dvorak bei einem Besuch in Wien 1877. Er hörte dort eine der Bläserserenaden Mozarts und ließ sich davon spontan zu seiner Serenade d-Moll, op. 44, anregen. Sie ist das Bläsergegenstück zu seiner viel berühmteren Streicherserenade und ebenso wie diese eine souveräne Stilisierung “im klassischen Stil”. Tschechische Volkstöne hauchen den Menuetten und Andantes neues Leben ein, während die Themen so berstend komisch oder sentimental gefühlig charakterisiert sind, dass eine Art Musik “über die Wiener Klassik” entsteht.
Wem Mozarts Bläserserenaden vertraut sind, dem wird auch dieser Zusammenhang in Dvoraks Serenade nicht entgehen, denn der Tscheche hat den Anfang seines Andante con moto nach dem Vorbild von Mozarts Adagio aus der Gran Partita geformt, was natürlich als Huldigung, nicht als Plagiat zu verstehen ist. Auch in der Besetzung hat sich Dvorak an Mozarts B-Dur-Werk für 12 Bläser und Kontrabass orientiert. Er setzte aber zusätzlich zum Kontrabass ein obligates Violoncello ein, was es ihm ermöglichte, die Farbpalette der Bläser dezent mit streicherischen Zutaten (Pizzicato etc.) zu würzen.
Wie fast immer bei Dvorak ist das Ergebnis von betörendem Klangreiz, und man kann kaum glauben, dass er dieses vor Einfällen überquellende Werk in nur 14 Tagen komponiert hat. In der Farbpallette lösen stilisierte böhmische Dorfmusik, romantisch-träumerische Pastellfarben und archaisch herbe Klänge einander ab.
Quelle: “Werke von Antonin Dvorák“ im Kammermusikführer von Villa Musica Rheinland-Pfalz
Die Streichquartette von Antonin Dvorák, die sich über 10 CDs erstrecken, wurden vom Verlag als separate Box aufgelegt, und von mir bereits 2012 veröffentlicht. (Zur Zeit leider vergriffen)
CD 1, Track 6: Klaviertrio Nr. 4 in e, op.90 'Dumky' - VI. Lento maestoso-vivace
CD 2, Track 2: Klaviertrio Nr. 3 in f, op 65 -. II. Allegro grazioso
CD 3, Track 6: Klavierquartett in Es, op. 87 - III. Allegro moderato, grazioso
CD 4, Track 6: Klavierquintett in A, op 81 - III. Scherzo, Furiant, molto vivace
CD 5, Track 6: Streichquintett in Es, op. 97 - II. Allegro vivo
CD 6, Track 5: Violinsonate in F, op. 57 - II. Poco sostenuto
CD 7, Track 3: Sonatine in G, op 100 - III. Scherzo
CD 8, Track 3: Drobnosti op. 75a - II. Capriccio, poco allegro
Gustav Meyrink
Tschitrakarna, das vornehme Kamel
»Bitt’ Sie, was ist das eigentlich: Bushido?« fragte der Panther und spielte Eichelas aus.
»Bushido? hm«, brummte der Löwe zerstreut. »Bushido?« »Na ja, Bushido«, — ärgerlich fuhr der Fuchs mit einem Trumpf dazwischen, — »was Bushido ist?«
Der Rabe nahm die Karten auf und mischte. »Bushido? Das ist der neueste hysterische ›Holler‹! Bushido, das ist so ein moderner ›Pflanz‹, — eine besondere Art, sich fein zu benehmen, — japanischen Ursprungs. Wissen Sie, so was wie ein japanischer ›Knigge‹. Man grinst freundlich, wenn einem etwas Unangenehmes passiert. Zum Beispiel, wenn man mit einem österreichischen Offizier an einem Tisch sitzen muß, grinst man. Man grinst, wenn man Bauchweh hat, man grinst, wenn der Tod kommt. Selbst wenn man beleidigt wird, grinst man. Dann sogar besonders liebenswürdig. — Man grinst überhaupt immerwährend.«
»Ästhetentum, mhm, weiß schon, — Oscar Wilde — ja, ja«, sagte der Löwe, setzte sich ängstlich auf seinen Schweif und schlug ein Kreuz, — »also weiter.«
»Na ja, und der japanische Bushido wird jetzt sehr modern, seit sich die slawische Hochflut im Rinnstein verlaufen hat. Da ist z. B. Tschitrakarna — —«
»Wer ist Tschitrakarna?«
»Was, Sie haben noch nie von ihm gehört? Merkwürdig! Tschitrakarna, das vornehme Kamel, das mit niemandem verkehrt, ist doch eine so bekannte Figur! Sehen Sie, Tschitrakarna las eines Tages Oscar Wilde, und das hat ihm den Verkehr mit seiner Familie so verleidet, daß es von da an seine eigenen einsamen Wege ging. Eine Zeitlang hieß es, es wolle nach Westen, nach Österreich, — dort seien nun aber schon so unglaublich viele ——«
»Kscht, ruhig, — hören Sie denn nichts?« flüsterte der Panther —. »Es raschelt jemand —«
Alle duckten sich nieder und lagen bewegungslos wie die Steine.
Immer näher hörte man das Rascheln kommen und das Prasseln von zerbrochenen Zweigen, und plötzlich fing der Schatten des Felsens, in dem die vier kauerten‚ an zu wogen, sich zu krümmen und wie ins Unendliche anzuschwellen — — —
Bekam dann einen Buckel, und schließlich wuchs ein langer Hals heraus mit einem hakenförmigen Klumpen daran.
Auf diesen Augenblick hatten der Löwe, der Panther und der Fuchs gelauert‚ um sich mit einem Satz auf den Felsen zu schnellen.
Der Rabe flatterte auf wie ein Stück schwarzes Papier, auf das ein Windstoß trifft.
Der bucklige Schatten stammte von einem Kamel, das den Hügel von der anderen Seite erklommen hatte und jetzt beim Anblick der Raubtiere in namenlosem Todesschreck zusammenzuckend sein seidenes Taschentuch fallen ließ.
Aber nur eine Sekunde machte es Miene zur Flucht, dann erinnerte es sich: — Bushido!! blieb sofort steif stehen und grinste mit verzerrtem käseweißem Gesicht.
»Tschitrakarna ist mein Name«, sagte es dann mit bebender Stimme und machte eine kurze englische Verbeugung, — »Harry S. Tschitrakarna! — — Pardon, wenn ich vielleicht gestört habe« — — dabei klappte es ein Buch laut auf und zu, um das angstvolle Klopfen seines Herzens zu übertönen.
Aha: Bushido! dachten die Raubtiere.
»Stören? Uns? Keineswegs. Ach, treten Sie doch näher«‚ sagte der Löwe verbindlich (Bushido), »und bleiben Sie, bitte, solange es Ihnen gefällt. — Übrigens wird keiner von uns Ihnen etwas tun, — Ehrenwort darauf, — mein Ehrenwort.«
Jetzt hat der auch schon Bushido, natürlich jetzt auf einmal, dachte der Fuchs ärgerlich, grinste aber ebenfalls gewinnend.
Dann zog sich die ganze Gesellschaft hinter den Felsen zurück und überbot sich in heiteren und liebenswürdigen Redensarten.
Das Kamel machte wirklich einen überwältigend vornehmen Eindruck.
Es trug den Schnurrbart mit den Spitzen nach abwärts nach der neuesten mongolischen Barttracht »Es ist mißlungen« und ein Monokel — ohne Band natürlich — im linken Auge.
Staunend ruhten die Blicke der vier auf den scharfen Bügelfalten seiner Schienbeine und der sorgfältig zur Apponyikrawatte geschlungenen Kehlmähne.
Sakerment, Sakerment, dachte sich der Panther und verbarg verlegen seine Krallen‚ die schwarze, schmutzige Ränder hatten vom Kartenspiel.
Leute von guten Sitten und feinem Takt verstehen einander gar bald.
Nach ganz kurzer Zeit schon herrschte das denkbar innigste Einvernehmen‚ so daß man beschloß, für immer beisammen zu bleiben.
Von Furcht war bei dem vornehmen Kamel begreiflicherweise keine Rede mehr, und jeden Morgen studierte es »The Gentlemans Magazine« mit derselben Gelassenheit und Ruhe wie früher in den Tagen der Zurückgezogenheit.
Zuweilen wohl des Nachts — hie und da — fuhr es aus dem Schlafe mit einem Angstschrei auf, entschuldigte sich aber stets lächelnd mit dem Hinweis auf die nervösen Folgen eines bewegten Vorlebens.
Immer sind es einige wenige Auserwählte, die ihrer Umgebung und ihrer Zeit den Stempel aufdrücken. Als ob ihre Triebe und ihr Fühlen wie Ströme geheimnisvoller lautloser Überredungskunst sich von Herz zu Herz ergössen, schießen heute Gedanken und Ansichten auf, die gestern noch mit kindlicher Angst das zagende, sündenreine Gemüt erfüllt hätten und die vielleicht schon morgen das Recht der Selbstverständlichkeit werden erworben haben.
So spiegelte sich schon nach wenigen Monaten der erlesene Geschmack des vornehmen Kamels überall wider.
Nirgends mehr sah man plebejische Hast.
Mit dem stetigen gelassenen, diskret schwingenden Schritte des Dandy promenierte der Löwe — weder rechts noch links blickend, und zum selben Zwecke wie weiland die vornehmen Römerinnen trank der Fuchs täglich Terpentin und hielt streng darauf, daß auch in seiner gesamten Familie ein gleiches geschah.
Stundenlang polierte der Panther seine Krallen mit Onglissa, bis sie rosenfarbig in der Sonne glänzten, und ungemein individuell wirkte es, wenn die Würfelnattern stolz betonten, sie seien gar nicht von Gott erschaffen worden, sondern, wie sich jetzt herausstelle, von Kolo Moser und der »Wiener Werkstätte« entworfen.
Kurz, überall sproßte Kultur auf und Stil, und bis in die konservativen Kreise drang modernes Fühlen.
Ja, eines Tages machte die Nachricht die Runde, sogar das Nilpferd sei aus seinem Phlegma erwacht, frisiere sich rastlos die Haare in die Stirne (sogenannte Giselafransen) — und bilde sich ein, es sei der Schauspieler Sonnental.
Da kam der tropische Winter.
Krschsch, Krschsch, Prschsch, Prschsch, Krschsch, Prschsch. So ungefähr regnet es zu dieser Jahreszeit in den Tropen. Nur viel länger.
Eigentlich immerwährend und ohne Unterlaß von Abend bis früh, von früh bis Abend.
Dabei steht die Sonne am Himmel, mies und trübfarbig, wie ein Lebkuchen.
Kurz, es ist zum Wahnsinnigwerden.
Natürlich wird man da gräßlich schlecht aufgelegt. Gar wenn man ein Raubtier ist.
Statt sich nun eben jetzt eines möglichst gewinnenden Benehmens zu befleißigen — schon aus Vorsicht —, schlug ganz im Gegenteil das vornehme Kamel des öfteren einen ironisch überlegenen Ton an, besonders, wenn es sich um wichtige Modefragen‚ Schick und dergleichen handelte, was naturgemäß Verstimmung und mauvais sang erzeugen mußte.
So war eines Abends der Rabe in Frack und schwarzer Krawatte gekommen, was dem Kamel sofort Anlaß zu einem hochmütigen Ausfall bot.
»Schwarze Krawatte zum Frack darf man — man sei denn ein Sachse — bekanntermaßen nur bei einer einzigen Gelegenheit tragen« — hatte Tschitrakarna fallen lassen und dabei süffisant gegrinst.
Eine längere Pause entstand, — der Panther summte verlegen ein Liedchen, und niemand wollte zuerst das Schweigen brechen, bis sich der Rabe doch nicht enthalten konnte, mit gepreßter Stimme zu fragen, welche Gelegenheit das denn sei.
»Nur‚ wenn man sich begraben läßt«‚ hatte die spöttische Erklärung gelautet‚ die ein herzliches, den Raben aber nur noch mehr verletzendes Gelächter auslöste.
Alle hastigen Einwendungen wie: Trauer, enger Freundeskreis, intime Veranstaltungen usw. usw. machten die Sache natürlich nur noch schlimmer.
Aber nicht genug damit, ein anderes Mal — die Sache war längst vergessen — als der Rabe mit einer weißen Krawatte, jedoch im Smoking, erschienen war, brannte das Kamel in seiner Spottlust förmlich nur darauf, die ver- fängliche Bemerkung anzubringen:
»Smoking? Mit weißer Krawatte? Hm! wird doch nur während einer Beschäftigung getragen.«
»Und die wäre?« war es dem Raben voreilig herausgefahren.
Tschitrakarna hüstelte impertinent: »Wenn Sie jemanden rasieren wollen.« — — —
Das ging dem Raben durch und durch. In diesem Augenblick schwor er dem vornehmen Kamel Rache bis in den Tod.
Schon nach wenigen Wochen fing infolge der Jahreszeit die Beute für die vier Fleischfresser an, immer knapper und spärlicher zu werden, und kaum wußte man, woher auch nur das Allernötigste nehmen.
Tschitrakarna genierte das natürlich nicht im geringsten; stets bester Laune, gesättigt von prächtigen Disteln und Kräutern, lustwandelte es, wenn die andern mit aufgespannten Regenschirmen fröstelnd und hungrig vor dem Felsen saßen, in seinem raschelnden wasserdichten Mackintosh — leise eine fröhliche Melodie pfeifend — in allernächster Nähe.
Man kann sich den steigenden Unwillen der vier leicht vorstellen.
Und das ging Tag für Tag so!
Mitansehen müssen, wie ein anderer schwelgt und selbst dabei verhungern!!!
»Nein, hol’s der Teufel«, hetzte eines Abends der Rabe (das vornehme Kamel war gerade in einer Premiere), »hauen wir doch dieses idiotische Gigerl in die Pfanne. Tschitrakarna!! Hat man denn was von dem Binsenfresser? — Bushido! — natürlich Bushido! — ausgerechnet jetzt im Winter; so ein Irrsinn. Und unseren Löwen — — Bitte, sehen Sie doch nur, wie er von weitem aussieht jetzt, — wie ein Gespenst — unseren Löwen, den sollen wir glatt verhungern lassen, hm? Das ist vielleicht auch Bushido, ja?«
Der Panther und der Fuchs gaben dem Raben rückhaltlos recht.
Aufmerksam hörte der Löwe die drei an, und das Wasser lief ihm zu beiden Seiten aus dem Maul, während sie ihm Vorstellungen machten.
»Töten? — Tschitrakarna?« — sagte er dann. »Nicht zu machen, gänzlich ausgeschlossen; pardon, ich habe doch mein Ehrenwort gegeben«, und erregt ging er auf und nieder.
Aber der Rabe ließ nicht locker: »Auch nicht, wenn es sich von selbst anbieten würde?«
»Das wäre natürlich was anderes«, meinte der Löwe. »Wozu aber all diese dummen Luftschlösser!«
Der Rabe warf dem Panther einen heimtückischen Blick des Einverständnisses zu.
In diesem Augenblick kam das vornehme Kamel nach Hause, hängte Opernglas und Stock an einen Ast und wollte eben einige verbindliche Worte sagen, da flatterte der Rabe vor und sprach:
»Weshalb sollen alle darben: — besser drei satt, als vier hungrig. Lange habe ich — — — —«
»Verzeihen Sie recht sehr, ich muß aber hier allen Ernstes — schon als Älterer — auf dem Rechte des Vortrittes bestehen«‚ damit schob ihn der Panther — nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Fuchs — höflich aber bestimmt zur Seite mit den Worten:
»Mich‚ meine Herrschaften, zur Stillung des allgemeinen Hungers anzubieten, ist mir nicht nur Bushido, ja sogar Herzenswunsch; ich äh — — ich äh — —«
»Lieber, lieber Freund, wo denken Sie hin«‚ unterbrachen ihn alle, auch der Löwe (Panther sind bekanntlich ungemein schwierig zu schlachten), »Sie glauben doch nicht im Ernst, wir würden — — — Ha‚ ha, ha.«
Verdammte Geschichte, dachte sich das vornehme Kamel, und eine böse Ahnung stieg in ihm auf. Ekelhafte Situation; — — aber Bushido, — übrigens — — ach was, einmal ist’s ja schon geglückt, also Bushido!!
Mit lässiger Gebärde ließ es das Monokel fallen und trat vor.
»Meine Herren, äh‚ ein alter Satz sagt: Dulce et decorum est pro patria mori! Wenn ich mir also gestatten darf — — «. Es kam nicht zu Ende.
Ein Gewirr von Ausrufen ertönte: »Natürlich, Verehrtester‚ dürfen Sie«, hörte man den Panther höhnen.
»Pro patria mori, juchhu, — dummes Luder, werde dir geben Smoking und weiße Krawatte«, gellte der Rabe dazwischen.
Dann ein furchtbarer Schlag, das Brechen von Knochen, und Harry S. Tschitrakarna war nicht mehr.
Tja, Bushido ist eben nicht für Kamele.
Quelle: Gustav Meyrink. Das Wildschwein Veronika. Die 20 frechsten Geschichten aus ›Des deutschen Spießers Wunderhorn‹. Fischer Taschenbuch 1796, Fischer, Frankfurt am Main, 1977. ISBN 3 436 02425 2. Seite 73-79
Online frei erhältlich: Gustav Meyrinks Wachsfigurenkabinett (Erstausgabe: Verlag Albert Langen, München, 1908)
Wem dieser Post gefallen hat, dem gefielen auch folgende Beiträge:
Mehr Gesamtausgaben: Robert Schumann: Kammermusik (Komplett) | "Soll man sich Sorgen machen? (aus dem "Buch ohne Titel" von Raymond M. Smullyan).
Mehr Humor: Fritz von Herzmanovsky-Orlando: "Maskenspiel der Genien". Mit Bildern von Hans Reiser. | Violinkonzerte von Mozart bzw. Mendelssohn: Jascha Heifetz, Violine.
Mehr Bilder: Michael Mathias Prechtl (1926-2004). Mozart, Wagner, Freud, Picasso, ... Man muß sie gesehen haben!
CD bestellen bei amazon
CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Pictures) 55 MB
embedupload --- MEGA --- Depositfile
Unpack x334.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the FLAC+CUE+LOG files 8 CDs


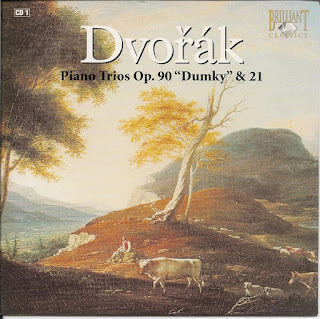




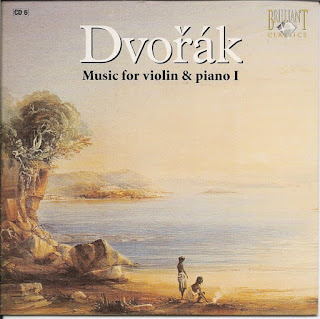
















































%20Chris%20Christodoulou%20(8).jpg)









































































.jpg)










































