Das Streichquartett als Idealtypus 'absoluter' Musik, wie er von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert zur Reife gebracht wurde, ist ganze 200 Jahre alt. Vor nunmehr rund 30 Jahren bestand die berechtigte Aussicht, daß diese Art von Musik, genau so wie Oper und Symphonie, 'überwunden' und passé sei. Der Avantgarde eröffneten sich damals, insbesondere mit der Elektronik, völlig neue Formmöglichkeiten und Klangquellen. Was sollte da noch das altmodische Streichquartett mit seiner Aura von Aristokratensalon und Winckelmannscher Klassizität?
Das Streichquartett war nichts für den breiten bürgerlichen Konsum. Die Gebildeten unter den Bürgern pflegten es - lieber noch als aktive, könnerhaft dilettierende Spieler denn als Hörer. Den erleseneren Kennern erschloß sich das durchsichtige Geflecht der vier Stimmen (heilige Vierzahl des profunden Tonsatzes!) vorzugsweise durchs Lesen. Lesen und Selbermusizieren als bevorzugte, wohl auch adäquateste Rezeptionsmodi des klassischen Streichquartetts, wohingegen das passive Hören eine geringere Rolle spielte - damit widersetzte sich ein gewichtiger Teil der Musik dem Trend zur allgemeineren, öffentlicheren Vermittlung und Teilhabe an 'Kulturgütern'.
Es ist eine Binsenwahrheit, daß die moderne Kammermusik spieltechnische Schwierigkeitsgrade erreicht hat, die ihre Wiedergabe zu einer Spezialistensache machen. Die Möglichkeit lesender oder laienhaft exekutierender Aneignung entfällt durchweg. Dennoch tragen auch zeitgenössische Streichquartette Erinnerungsspuren an diese Rezeptionsformen mit sich.
Wolfgang Rihm gehört zu einer Generation, die sich kritisch von den 'Gesetzgebern' der Avantgarde (Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono) absetzte. Sie rieb sich an einem zum Dogma erhobenen Antitraditionalismus. Dabei ging es ihm nicht um 'neue Einfachheit' (so ein ungenau bezeichnendes Schlagwort, unter das auch Rihm bisweilen subsumiert wurde), sondern um Wiedergewinn einer tönenden Unmittelbarkeit. Diese schien allzulange gefangengehalten, verledert in Konstruktion. Ausbruch ist Rihms primärer Komponierimpuls. Er ist es auch in Rihms reifen Jahren geblieben.
Die von Rihm repräsentierte neue ästhetische Dialektik erkannte Fortschrittspotential auch in scheinbarer Rückwendung. Das Streichquartett wurde mithin für Rihm nicht zum Medium einer konsolidierten, abgespannt 'gemäßigten' Komponierhaltung, sondern Austragsort gesteigerter tonsprachlicher Unmittelbarkeit. Das Nichtöffentliche, Hermetische der Gattung korrespondierte mit dem Tagebuch- und Bekenntnischarakter der ihr anvertrauten Botschaft. Zugleich etablierte sich die Werkreihe der Rihmschen Streichquartette aber auch insgeheim als Block traditionsbewußter 'Meisterwerke'. Rihm ist, indem er ganz unser hellwacher Zeitgenosse ist, unter anderem eben auch eine echte Künstlergestalt des 19. Jahrhunderts.
 |
| Wolfgang Rihm |
DRITTES STREICHQUARTETT [1976] IN SECHS SÄTZEN
IM INNERSTEN ist Rihms drittes Streichquartett betitelt. In der von Adorno geprägten deutschen Geisteslandschaft berührt dieser Titel geradezu ein Tabu: Berufung auf 'Innerlichkeit' war der Kritischen Theorie hochgradig ideologieverdächtig. Rihm spielt mit solchen dubiosen Sinn-Assoziationen eher, als daß er sie naiv adaptierte. IM INNERSTEN ließe sich auch nüchterner verstehen: als intensivierte Klangforschung, als tiefes Hineinloten in die Semantik musikalischer Gesten, Farben und Proportionen. Tatsächlich begab sich Rihm, ungeachtet aller 'Unmittelbarkeit', niemals seiner konstruktivistischen Energien. Die Prämissen der Avantgarde sind bei ihm, gut hegelisch, 'aufgehoben'.
Das dritte Streichquartett besteht aus sechs knappen Satzcharakteren, die aphoristisch anmuten, aber auch durch eine gewisse Bedächtigkeit gekennzeichnet sind. Schroff und heftig gibt sich, in vehementen Schüben oder auch längeren Anläufen, das erste Stück. Es führt kurz vor Schluß zu einem wie ein Beethoven-Einsprengsel anmutenden Unisono-Pizzicato auf den Tönen a und as.
Zunächst ruhiger, von Lineaturen durchfochtener ist der zweite Satz, der sich dann in aufschreiartigen, zwanghaft wiederholten Rhythmusmustern festfrißt, ehe er in einem langen, dämmernden Pianissimo erstirbt. Der dritte, con sordino zu spielende Satz wendet seine anfangs behutsame Rhetorik bald wieder ins wild Aufzuckende, Katastrophische. Es folgt [Äußerst gedehnt] ein in überwiegend leiser, verhaltener Insistenz bohrendes Klangbild. Der Schluß ist gleichsam extrem ausgespreizt: während zweite Geige und Bratsche verlöschen, crescendiert die erste Geige in höchster Lage zum vierfachen Fortissimo. Wiederum dramatisch ausgespannt zwischen motorisch bewegten Partien und gehaltenen Tönen der 5. Satz. Ihm schließt sich ein geräuschhaft-leises Zwischenspiel [quasi niente] an. Der Schlußsatz wird geprägt durch eine 'künstliche' Fixierung der jeweils angesetzten dynamischen Werte - es gibt keine 'natürlich' schwellende, atmende Tongebung. Der musikalische Ausdruck versucht, mit diesem Kunstgriff eine sprachliche Meta-Ebene zu erreichen.
OHNE TITEL
FÜNFTES STREICHQUARTETT [1981-1983] IN EINEM SATZ
Acht Jahre liegen zwischen dem dritten und dem fünften Streichquartett, als dessen Beendigungsdatum die Partitur den 6. Oktober 1983 angibt. Über den Unterschied zum früheren Opus belehrt nicht zuletzt die Handschrift des Komponisten: dort wirkte sie sorgfältig, fast ziseliert. Hier erscheint sie wild, eruptiv, skizzenhaft. Das Werk klingt auch so, als sei es unter ungeheurem Druck entstanden - magmaartig ausgeschleuderte Tonfluten, wie in Trance und ohne wägende Ratio Niedergeschriebenes. Zweifellos entstand die Komposition in kürzester Zeit, und sie spiegelt einen rauschhaften Schaffenszustand, ergießt sich in einem einzigen rhetorischen Riesenbogen. 'Schnell, rastlos' ist auch die durchgängige Vortragsbezeichnung des stürmischen, in Dauerspannung gehaltenen einzigen Satzes. Selten dürfte Musik der surrealistischen Maxime einer 'écriture automatique' so nahe gekommen sein wie hier.
ACHTES STREICHQUARTETT [1987-1988]
IN EINEM SATZ
OHNE TITEL ist das fünfte Streichquartett überschrieben, als habe seine Radikalität ausdrücklich etwas sehr Persönliches zu verschweigen. Das Achte Streichquartett, gibt sich wieder schlichter, gelassener. Der einzige Satz integriert auf engem Raum eine Fülle antagonistischer Charaktere. Sie werden durchweg grell gegeneinandergesetzt, selten moderierend miteinander vermittelt. Das Plötzliche, Abrupte, Harsche bleibt Rihms bevorzugter Redegestus. Meisterlich werden inkorporierte Zitate, quasitonale 'Flecken' und eruptive Ausbruchsfiguren gegeneinander gehalten - souverän werden zudem spielerisch-theatralische Elemente aus dem avantgardistischen Fundus gehandhabt (Rascheln mit Papier, simuliertes 'Schreiben' mit der Bogenspitze auf dem Notenpapier).
So beschreibt die Bewegung vom dritten über das fünfte zum achten Streichquartett so etwas wie einen tonsprachlichen Dreischritt: Von der klangerkundenen Introspektion [III] über die rigorose expressive Entäußerung [V] zur (unharmonisierten) Synthese der Gegensätze [VIII].
Quelle: Hans-Klaus Jungheinrich: Botschaften; im Booklet
Track 4: III. Streichquartett - IV. äußerst gedehnt
TRACKLIST Wolfgang Rihm (°1952) Streichquartette - quatuors à cordes - string quartets Arditti String Quartet: Irvine Arditti, violon David Alberman, violon Garth Knox, alto Rohan de Saram, violoncelle Im Innersten III. Streichquartett - III Quatuor à cordes [1976] en six mouvements 26:56 dédicace Alfred Schlee zum Geburtstag 01 I. schroff 2:10 02 II. 3:54 03 III. 1:55 04 IV. äußerst gedehnt 5:11 05 V. 3:17 06 Zwischenspiel, senza tempo 0:57 07 VI. 9:30 08 Achtes Streichquartett - VIII Quatuor à cordes [1987 - 1988] en un mouvement 15:03 composé à l'intention du Quatuor Arditti commande de la Società del Quartetto di Milano pour son centvingt-cinquième anniversaire création le 17 janvier 1989 à Milan 09 ohne Titel V. Streichquartett - V Quatuor à cordes [1981-1983] en un mouvement 25:52 composé à l'intention du Quatuor Arditti création le 6 decembre 1983 à Bruxelles durée totale 68:27 Recorded November 1990, Studio Deutschlandfunk (WDR), Köln Recording supervision: Siegfried Spittler Sound Engineer: Mark Hohn - Executive Producer: Harry Vogt arditti quartet edition 11 (c) 1991
Jacques-Henri Lartigue: Grand Prix de l'A.C.F., 1912
Das Tempo unserer Zeit
 |
| Jacques-Henri Lartigue: Grand Prix de l'A.C.F., 1912 |
Er liebt schicke Automobile. Aber welcher Junge in seinem Alter tut das nicht? Er beobachtet die ersten Flieger, wie sie sich kühn in die Lüfte schwingen, ist Zeuge unerhörter technischer Neuerungen und zeigt sich fasziniert vom Geschwindigkeitsrausch seiner Zeit. Im Unterschied zum Gros seiner Altersgenossen freilich nimmt der kleine Jacques Haguet Henri Lartigue, so sein Taufname, unmittelbar Anteil am Geschehen. Die Familie ist vermögend - eine Zeit lang gilt sie als die achtreichste Familie Frankreichs - und der Vater, ein bekannter Eisenbahndirektor, Bankier und Verleger, allem Neuen gegenüber ausgesprochen aufgeschlossen. Bereits 1902 nennt die Familie ein erstes Automobil ihr eigen. Dem Modell Krieger folgt ein von Million Guiet karossierter Panhard-Levassor, dann ein Peugeot und schließlich ein Hispano Suiza - zugleich Höhepunkt des privaten Fuhrparks, bevor die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg auch das Vermögen der Lartigues dahinschmelzen lässt. Aber noch schreiben wir glücklichere Zeiten. Es ist die Ära der viel gepriesenen Belle Époque. Und die Familie Lartigue gefällt sich in allen möglichen standesgemäßen Divertimentos. Man fährt im Winter an die Riviera (die Sommersaison ist noch nicht erfunden), sonntags in den Bois de Boulogne oder zu einem der nicht gerade seltenen Automobilrennen rund um Paris. Und weil das Schöne sich als gar so flüchtig erweist, wird es zumindest fotografisch festgehalten.
Schon Vater Lartigue scheint ein begeisterter Amateurfotograf gewesen zu sein. »Papa fotografiert«, schreibt Jacques-Henri in seinen Mémoires sans Mémoire. »Die Fotografie ist eine geheimnisvolle Angelegenheit. Eine Sache, die seltsam riecht, bizarr und eigentümlich, und die man sofort lieben muss.« Lartigue ist sieben Jahre alt, als er 1901 seinen ersten Fotoapparat bekommt. »Papa«, notiert er, »kommt mir vor wie der liebe Gott. Er sagt: 'Ich werde dir einen richtigen Fotoapparat schenken.'« Letzterer erweist sich als zeittypische große, schwere Holzkamera für Glasnegative 13 x 18 cm. Ein Gerät, das eigentlich viel zu unhandlich für den zarten und schmächtigen Lartigue ist. Doch der begreift sein neues Medium rasch als technische Verfeinerung jener - wie er sie nennt »Engelsfalle«, mit deren Hilfe Jacques-Henri, kaum hat er Laufen gelernt, die sichtbare Welt um sich herum zu archivieren beginnt: »Ich schließe dreimal kurz die Augen, drehe mich um die eigene Achse und schwupp! das Bild ist mein.« So wird ihm die Fotografie schon bald zum wichtigen Instrument der visuellen Erkundung. Nicht einfach Zeitvertreib, sondern eine sehr ernsthafte Beschäftigung, die schon beim kleinen Lartigue von der überlegt gestalteten Aufnahme bis hin zum Entwickeln und Vergrößern in der Dunkelkammer reicht.
 |
| Jacques-Henri Lartigue: Grand Prix de l'A.C.F., 12. Juli 1913 |
Lartigue fotografiert sein Zimmer, seine Spielsachen und Möbel. Dann das Haus, den Garten, die Dienstboten, Mama, Papa oder Zissou, seinen älteren Bruder. Kontinuierlich weitet sich sein Horizont. Das hatte er sich schließlich immer schon gewünscht: den Lauf der Dinge anhalten, das Tempo der Zeit bremsen zu können, immerfort Kind bleiben zu dürfen, dem sich, wenn man so will, die technische Welt als überdimensionales Arsenal von Spielsachen erschließt. Lartigue fotografiert Autos und immer wieder Autos. Er bannt Flugzeuge auf seine Platten und Zeppeline. Er tut dies mit anhaltender Begeisterung und einem bemerkenswerten Blick. Vor allem aber mit einem bewundernswerten, quasi intuitiven Verständnis für die ikonographischen Besonderheiten seines Mediums. »Diese Bilder«, sollte jahrzehnte später kein Geringerer als John Szarkowski urteilen, »sind die Beobachtungen eines Genies: frisch in der Auffassung, poetisch in der Anmutung und grafisch in der Umsetzung.«
18 Jahre alt ist Lartigue, als ihm sein inzwischen wohl berühmtestes Bild gelingt. Wir schreiben den 25. Juni 1912, und die Familie ist aufgebrochen, um bei Le Tréport den Großen Preis des Automobile Club de France mitzuerleben. Noch immer gilt Frankreich als Automobilnation Nummer eins. Mehr als 200 Autohersteller werben um die Gunst der Kunden. Zum Vergleich: rund 100 sind es in den USA, in England etwa 60 und etwas mehr als 30 im Deutschen Reich. Bis Ende der 1920er Jahre bleibt das Land Europas wichtigster Produzent von Kraftfahrzeugen und bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges international der bedeutendste Exporteur. In Frankreich erscheint mit l'Auto ab Oktober 1900 die erste Fachzeitschrift rund ums Automobil, nebenbei: ein Blatt, das Jacques-Henri Lartigue seit 1908 abonniert hat. Auch die ersten Straßenrennen finden in Frankreich statt. Allgemein gilt der Wettbewerb Paris-Rouen (1894) als erster seiner Art. Weitere Wett- und Erprobungsfahrten führen etwa von Paris nach Bordeaux, von Paris nach Toulouse, von Paris nach Ostende oder Wien. Dabei geht es über staubige, meist ungesicherte Landstraßen. Platte Reifen durch herumliegende Hufnägel sind die Norm, gebrochene Achsen keine Seltenheit. Selbst tödliche Unfälle sind wohl unvermeidlicher Teil eines Spektakels, dem sich Lartigue - ungeachtet tragischer Momente - nicht entziehen kann. »Um 14 Uhr«, vertraut er unter dem Datum des 25. Juni 1912 seinem Tagebuch an, »kein Wagen mehr zu sehen. Das Rennen ist für heute zu Ende. Im Hotel wird uns mitgeteilt, dass Hemery quicklebendig ist! Colinet hat es erwischt. Er ist verletzt, sein Mechaniker tot.«
Dem Bild lange Zeit keine Bedeutung beigemessen
Grand Prix de l'A.C.F., so der offizielle Titel des Bildes, entsteht am 26. Juni 1912. Es ist dies der zweite Tag des Grand Prix und das Foto Teil einer insgesamt 169 Aufnahmen umfassenden Serie. Lartigue fotografiert jetzt mit einer Ica Reflex für 9 x 12 cm Glasnegative. Die Originalkamera trägt die Seriennummer 489955 und hat als Objektiv ein Zeiss Tessar 1:4,5 150 mm. Das Besondere an dieser vergleichsweise großen Kamera mit oben liegender Mattscheibe ist ein horizontaler Schlitzverschluss, durch den sich die elliptische Form der hinteren Räder erklärt. Ganz offensichtlich hat Lartigue die Kamera mitgezogen. Daher bleibt die Umgebung verwischt, während die Karosserie des Automobils sowie die beiden Fahrer scharf wiedergegeben sind. Dass der komplette Kühler des Wagens vom Typ Schneider dem Bildrahmen zum Opfer fällt, dürfte kaum dem Wunsch des Autonarren Lartigue entsprochen haben, der sich ansonsten stets um Totalen bemüht hat.
 |
| Jacques-Henri Lartigue: Course de côte de Gaillon, 6. Oktober 1912 |
Anfang der 1960er Jahre ist Jacques-Henri Lartigue - gemäß der eigenen Lebensmaxime - nach wie vor ein glücklicher Mensch - und gänzlich unbekannt: als Fotograf ein Amateur im Wortsinn, der ohne auf »Kunst« zu schielen seinen persönlichen Lebensraum erkundet; als Maler soweit akzeptiert, dass gelegentlich eines seiner Bilder einen mutigen Käufer findet. Eine Einladung führt Lartigue 1962 in die USA. Und hier geschieht nun das, was Lartigues dritte Frau Florette später immer wieder als »Wunder« bezeichnet hat. Auf der Überfahrt in die USA begleitet sie ihren 26 Jahre älteren Gatten. Und weil sie um die Langeweile auf einem Frachter weiß, hat Florette Lartigue einen Stapel Fotos mitgenommen, um diese an Bord auszuflecken. In New York angekommen, trifft das Ehepaar Charles Rado, der vor dem Krieg in Frankreich eine Fotoagentur betrieben hatte und nun in den USA als Agent tätig ist. »Im Laufe der Unterhaltung«, erinnert sich Florette Lartigue, »kam das Gespräch auf die Fotografie, und Jacques meinte, er selbst fotografiere seit seiner Kindheit.« Charles Rado zeigt sich interessiert und man zeigte ihm den Stapel der mitgebrachten Aufnahmen. Rado verspricht, die Arbeiten bekannt zu machen. Tatsächlich bietet er sie noch am selben Tag der Illustrierten Life an. Etwas später zeigt er sie John Szarkowski, seit kurzem in der Nachfolge Edward Steichens Direktor der Fotoabteilung am Museum of Modern Art.
»Was ich damals für das Gesamtwerk hielt«, so Szarkowski im Rückblick, »bestand aus zwei größeren Kladden und einem Stapel von 52 Einzelbildern. Letztere waren, wenn ich mich recht erinnere, spätere Abzüge, während die Kladden alle möglichen Aufnahmen enthielten: kleine gelbliche Kontakte, größere Abzüge, Vergrößerungen auf verschiedensten Papieren […]. Die Abzüge waren in dem Bemühen eingeklebt, möglichst jeden Quadratzentimeter der Seite auszunutzen, und verweigerten sich mit rührender Unbekümmertheit jeglichem mir bekannten Gestaltungsprinzip, ob nun traditionell oder modern. Die Bilder selbst machten mich staunen. Zunächst wegen ihrer Einfachheit, Grazie und grafischen Anmutung. Ihre Wirkung - wie bei einem guten Sportler - zogen sie aus sparsamsten Mitteln, Eleganz und selbstverständlicher Genauigkeit. Mir schien, als blickte ich auf das frühe, unentdeckte Werk von Cartier-Bressons Papa.«
Szarkowski ist hingerissen von dem Material und beschließt, obwohl er es hier mit einem völlig unbekannten, 68-jährigen Amateurfotografen zu tun hat, Jacques-Henri Lartigue unverzüglich eine Einzelausstellung im Museum of Modern Art zu widmen. Erstens, so seine Überlegungen, würde er sich als junger Direktor hier auf Anhieb mit einer echten Entdeckung einführen können. Und zweitens ließ sich mit Lartigue der Boden für jene »neue Bildsprache« bereiten, als deren Apologet sich Szarkowski in der Folge tatsächlich erweisen sollte. Lartigue, argumentierte er folglich im Katalog, »sah den Augenblick, sah flüchtige Bilder, die sich dem Zufall sich überschneidender Formen verdankten […]. Und genau hier liegt denn auch der Kern des modernen fotografischen Sehens: Nicht Objekte werden wahrgenommen, sondern die durch sie erzeugten Bilder.«
 |
| »Hooked on Speed«: Lartigues Grand Prix de l'A.C.F. als Aufmacher des Life-Partfolios, 29. November 1963 |
Lartigues erste Ausstellung, zugleich sein - wie wir heute sagen würden - Coming out als Fotograf, eröffnete am 1. Juli 1963 im New Yorker Museum of Modern Art und war anschließend in 16 weiteren Städten in den USA und Kanada zu sehen. Der begleitende, schmale Katalog mit insgesamt 43 Abbildungen brachte Grand Prix de l'A.C.F. auf Seite 27. Als (allerdings stark beschnittenen) Aufmacher präsentierte die Illustrierte Life das Bild, die in ihrer Ausgabe vom 29. November Lartigue ein umfängliches Portfolio widmete. Doch damit nicht genug der Zufälle oder »Wunder« um Lartigues ebenso plötzlichen wie weltweiten Ruhm als Chronist der Belle Époque (so jedenfalls wurde er zunächst vor allem rezipiert). Am 22. November 1963 war John F. Kennedy in Dallas ermordet worden. »Wir nahmen es mit Bestürzung zur Kenntnis, in die sich zusätzlich Enttäuschung mischte«, erinnert sich Florette Lartigue. »Wir waren sicher, dass die Jacques zugedachten Seiten nunmehr der dramatischen Aktualität dieses Herbstes 1963 zum Opfer fallen würden. Tatsächlich aber war es so, dass sich die Aufnahmen von der Tragödie in Dallas und Jacques' unbeschwerte Bilder die Seiten von Life teilten. Der Titelgeschichte wegen fand nun gerade dieses Heft reißenden Absatz.« Mehr noch: Es war dies, wie Mary Blume unterstreicht, eine der meistverkauften Life-Ausgaben überhaupt. So avancierte Jacques-Henri Lartigue gewissermaßen über Nacht »zu einem der bekanntesten und populärsten Fotografen seiner Zeit«.
Vor allem seine Aufnahme Grand Prix de l'A.C.F. ist in der Folge immer wieder reproduziert worden. Das Bild fehlt in praktisch keiner Lartigue-Monografie. Gleichsam programmatisch stellt es das Umschlagmotiv der kleinen Lartigue-Ausgabe in Robert Delpires Taschenbuchedition Photo Poche. Der Stern (52/1979) brachte die Aufnahme in Ankündigung eines Auto-Specials auf den Titel. In jüngster Zeit wird das Bild vermehrt von Mathematikern, Psychologen oder Phänomenologen angefordert, wenn es bestimmte Sachverhalte zu illustrieren gilt. Selbst Geschäftsberichte meinen auf das Foto nicht verzichten zu können, wenn es um die Visualisierung von Dynamik im Wirtschaftsleben geht. Für Lartigue selbst war die Aufnahme nur eine von rund 100000. »Wie schade, dass ich keine Gerüche fotografieren kann«, hatte er sich als Kind beklagt. Die Zeit zu bannen, ist ihm immerhin gelungen. So steht Grand Prix de l'A.C.F. auch und nicht zuletzt beispielhaft für Wahrnehmung, für unser Sehen im Zeitalter des Überschalls: ein Sinnbild für das Tempo unserer hochtechnisierten Gegenwart.
Quelle: Hans-Michael Koetzle: Photo Icons. Die Geschichte hinter den Bildern. (Band I:) 1827-1926. Taschen, Köln, (Jubiläumsausgabe) 2008, ISBN-978-3-8365-0801-8. Zitiert wurden Seite 152-159.
 |
| Lartigues berühmtes Bild als Cover- und Aufmacherfoto eines Portfolios im Stern, 52/1979 |
Spross einer wohlhabenden Pariser Familie. 1894 in Courbevoie geboren.
Erste Kamera mit acht, erste eigenständige Aufnahmen mit zehn Jahren.
1915 Kunststudium in Paris.
Zahlreiche Ausstellungen im Paris der 30er Jahre. Freundschaft u. a. mit Picasso und Cocteau.
1963 erste Ausstellung seiner Fotografien im Museum of Modern Art, New York.
Erste Ausstellung in Deutschland 1966 auf der »photokina«.
1970 Buchpublikation Diary of a Century, herausgegeben von Richard Avedon.
Fotoarchiv seit 1979 als Donation J.-H. L. im Besitz des französischen Staates.
1984 Kulturpreis der DGPh.
1986 Offizier der Ehrenlegion. Im selben Jahr in Nizza verstorben
CD Info and Scans (Tracklist, Covers, Booklet, Music Samples, Pictures) 50 MB
embedupload ---- MEGA ---- Depositfile --- bigfileUnpack x198.rar and read the file "Download Links.txt" for links to the Flac+Cue+Log Files [68:27] 4 parts 300 MB
Reposted on April 7th, 2016











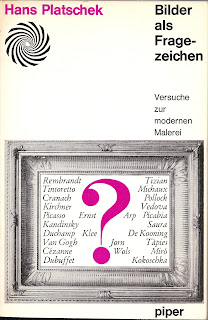





















%20Chris%20Christodoulou%20(8).jpg)









































































.jpg)










































